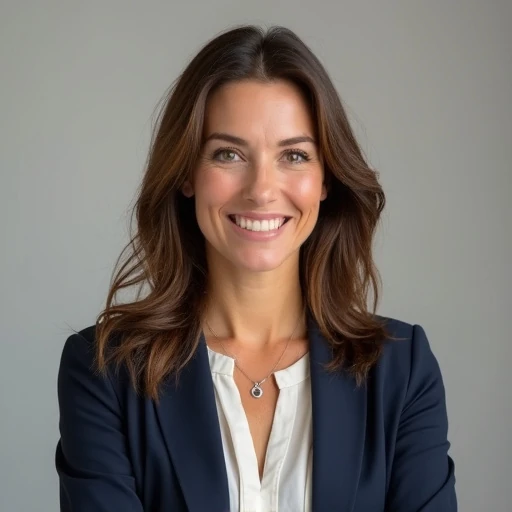Der Klimawandel wirkt sich im Alpenraum deutlich stärker aus als im globalen Durchschnitt. Experten warnen, dass eine globale Erwärmung um drei Grad Celsius für Salzburg eine Erwärmung von vier bis fünf Grad bedeuten könnte. Dies hätte tiefgreifende Folgen für die Region, von zunehmender Sommertrockenheit und Extremwetter bis hin zu massiven Veränderungen im Wintertourismus.
Der Salzburger Meteorologe Michael Butschek von Geosphere Austria erklärt die bereits heute sichtbaren und die zukünftig zu erwartenden Entwicklungen. Die Prognosen bis zur Mitte des Jahrhunderts sind weitgehend festgelegt, doch heutige Maßnahmen sind entscheidend, um die langfristigen Auswirkungen abzumildern.
Wichtige Erkenntnisse
- Der Alpenraum erwärmt sich etwa doppelt so schnell wie der globale Durchschnitt.
- Eine globale Erwärmung um 3°C könnte für die Alpen eine Erwärmung von 4-5°C bis 2050 bedeuten.
- Die Sommer werden trockener, während die Winter niederschlagsreicher, aber in tiefen Lagen regenreicher werden.
- Extremwetterereignisse wie Starkregen und die damit verbundenen Gefahren wie Murenabgänge nehmen zu.
- Der Wintertourismus steht vor großen Herausforderungen, besonders in Skigebieten unter 1.500 Metern.
Beschleunigte Erwärmung im Alpenraum
Während weltweit über eine Erwärmung von 1,5 Grad Celsius diskutiert wird, sind die Temperaturanstiege in Europa und insbesondere in den Alpen bereits deutlich höher. Seit den 1980er-Jahren steigen die Temperaturen hier rund doppelt so schnell wie im weltweiten Mittel. Diese Entwicklung hat spürbare Konsequenzen für das empfindliche Ökosystem der Alpen.
Laut dem „Zweiten Österreichischen Sachstandsbericht zum Klimawandel“ (AAR2) hat sich Österreich im Vergleich zum Jahr 1900 bereits um durchschnittlich 3,1 Grad Celsius erwärmt. Klimaforscher prognostizieren, dass eine globale Erwärmung von drei Grad bereits um das Jahr 2050 erreicht werden könnte, was für den Alpenraum einen Temperaturanstieg von vier bis fünf Grad bedeuten würde.
Ein fast unvermeidlicher Pfad bis 2050
Michael Butschek, Meteorologe bei Geosphere Austria in Salzburg, betont, dass die Entwicklung bis zur Mitte des Jahrhunderts bereits „vorgezeichnet“ sei. Die Klimamodelle zeigen für diesen Zeitraum nur geringe Unterschiede zwischen einem Szenario ohne Klimaschutz und einem mit ambitionierten Maßnahmen. Die heute getroffenen Entscheidungen werden ihre volle Wirkung erst gegen Ende des Jahrhunderts entfalten.
„Die Maßnahmen, die wir jetzt setzen, entfalten ihre Wirkung erst gegen Ende des Jahrhunderts. Nichtsdestotrotz sind sie besonders wichtig, um die Entwicklung auf lange Sicht abzuschwächen“, so Butschek im Gespräch mit Salzburg News Today.
Mehr Extremwetter: Starkregen und Dürre
Eine der direktesten Folgen der Erderwärmung ist die Zunahme von Extremwetterereignissen. Die physikalische Grundlage dafür ist einfach: Eine wärmere Atmosphäre kann mehr Wasserdampf aufnehmen. Dies führt bei Gewittern zu intensiveren Niederschlägen in kürzerer Zeit.
Die Zunahme von Starkregen
Statistiken belegen diesen Trend bereits. Vergleicht man die 30-Jahres-Perioden von 1961-1990 und 1991-2020, so hat sich der maximale stündliche Niederschlag in Österreich um 15 Prozent erhöht. In diesem Zeitraum betrug die Erwärmung im Land 1,2 Grad Celsius. Dieser Anstieg erhöht das Risiko von Murenabgängen und Felsstürzen, die auch durch das Auftauen von Permafrostböden in höheren Lagen begünstigt werden.
Faktencheck: Niederschlagsverschiebung
Obwohl die Intensität der Regenfälle zunimmt, wird sich die Gesamtmenge des Jahresniederschlags kaum ändern. Stattdessen findet eine saisonale Verschiebung statt: Die Sommer werden tendenziell trockener, während ein Großteil des Niederschlags in den Wintermonaten fällt.
Die wachsende Gefahr der Sommertrockenheit
Weniger Regen im Sommer bei gleichzeitig höheren Temperaturen verschärft die Trockenheit. Die Verdunstung nimmt zu, was den Wasserkreislauf zusätzlich belastet. Zudem verlängert sich die Vegetationsperiode, wodurch Pflanzen länger Wasser aus dem Boden ziehen. Starkregen kann dieses Defizit nur bedingt ausgleichen, da das Wasser oft oberflächlich abfließt und nicht tief in den Boden eindringen kann.
Auswirkungen auf den Winter und Tourismus
Die Klimaerwärmung wird das Gesicht des Winters in Salzburg nachhaltig verändern. Während die Niederschlagsmenge im Winter zunehmen wird, fällt dieser in tieferen Lagen immer häufiger als Regen statt als Schnee.
„Es wird aber auch in Zukunft noch Wetterlagen geben, wo es bis ganz herunter schneit“, versichert Butschek. Solche Ereignisse hängen von spezifischen Wetterlagen ab, bei denen Kaltluft aus der Polarregion nach Mitteleuropa gelangt. „Aber es wird seltener sein“, fügt er hinzu. Langfristige Beobachtungen zeigen bereits einen klaren Rückgang der Tage mit Schneebedeckung.
Herausforderungen für Skigebiete
Die Situation für den Wintertourismus wird zunehmend prekär, insbesondere für niedrig gelegene Skigebiete. Die Bedingungen für die Produktion von technischem Schnee werden durch höhere Temperaturen ebenfalls erschwert.
- Tiefe Lagen: Skigebiete unter 1.500 Metern Seehöhe werden es immer schwieriger haben, einen durchgehenden Betrieb zu gewährleisten.
- Künstliche Beschneiung: Obwohl technischer Schnee den Mangel an Naturschnee vorerst kompensieren kann, steigen die Kosten und der Energieaufwand.
- Höhere Lagen: Paradoxerweise könnten Lagen über 1.800 Metern in manchen Wintern sogar mehr Schnee verzeichnen, da der zusätzliche Winterniederschlag dort als Schnee fällt.
Das Schicksal der Gletscher
Für die heimischen Gletscher ist die Prognose düster. Derzeit verlieren sie rund fünf Prozent ihrer Masse pro Jahr. Dieser Rückzug ist eines der sichtbarsten Zeichen des Klimawandels in den Alpen.
Experten gehen davon aus, dass bis zum Ende des Jahrhunderts nur noch wenige Gletscher in den Westalpen übrig sein werden. Einige, wie der Hallstätter Gletscher, könnten laut aktuellen Berechnungen bereits in den nächsten fünf Jahren vollständig verschwunden sein. Dieser Verlust hat nicht nur symbolische Bedeutung, sondern beeinflusst auch den Wasserhaushalt der gesamten Region.