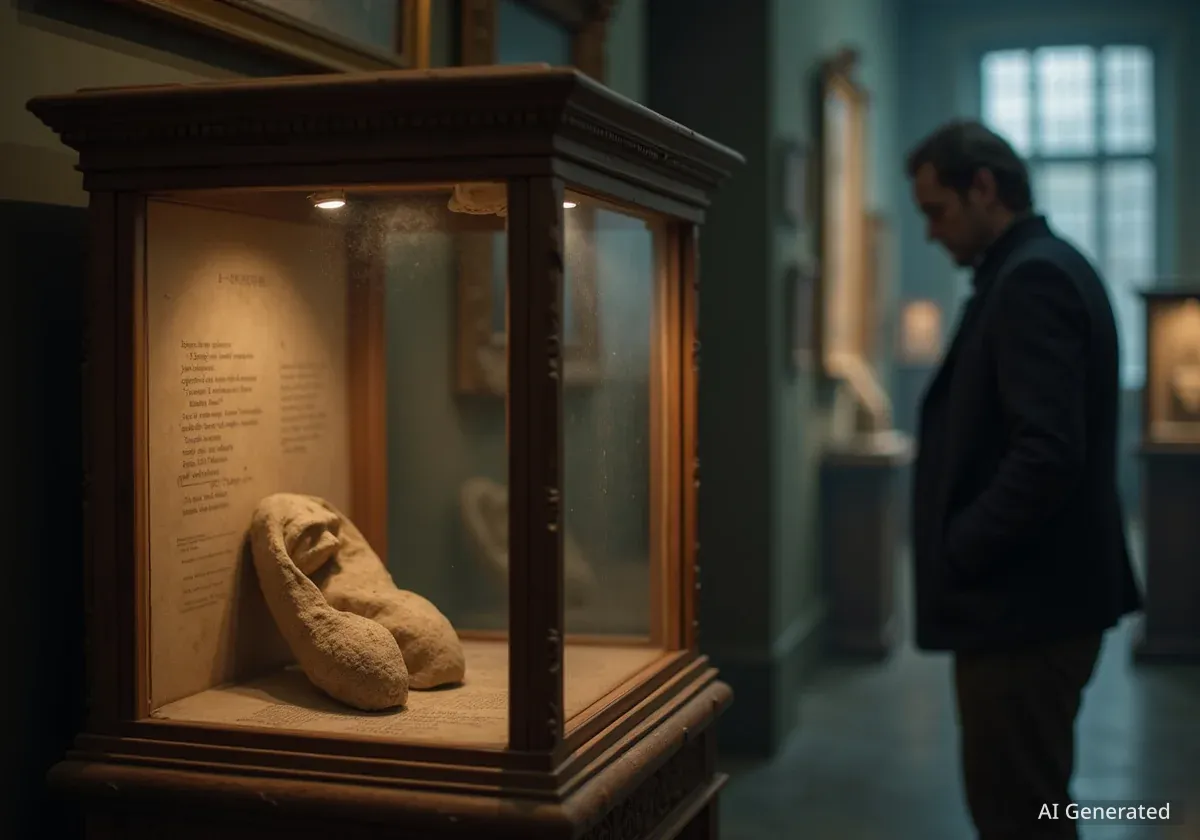Die Stadt Salzburg und ihr Bundesland haben lange gebraucht, um sich mit der nationalsozialistischen Vergangenheit einiger ihrer prominentesten Kulturschaffenden auseinanderzusetzen. Über Jahrzehnte hinweg wurden Persönlichkeiten wie Tobi Reiser, eine Schlüsselfigur der alpenländischen Volkskultur, geehrt, während ihre Verstrickungen in das NS-Regime weitgehend ignoriert wurden. Erst durch wiederholte journalistische Recherchen begann ein langsamer, aber unumkehrbarer Prozess der Neubewertung.
Dieser Prozess zeigt, wie tief verwurzelt Mythen sein können und wie schwierig es für eine Gesellschaft ist, das Bild ihrer Helden zu korrigieren. Die Debatten um Namensgebungen von Straßen, Plätzen und Preisen sind dabei nur die sichtbaren Zeichen eines tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandels im Umgang mit der eigenen Geschichte.
Die wichtigsten Fakten
- Journalistische Aufdeckungen, insbesondere durch die "Salzburger Nachrichten", brachten die NS-Vergangenheit von Salzburger Kulturgrößen wie Tobi Reiser ans Licht.
- Tobi Reiser, Gründer des berühmten Salzburger Adventsingens, war überzeugter Nationalsozialist und Mitglied der SS.
- Die öffentliche Auseinandersetzung führte zur Umbenennung von Straßen und Plätzen sowie zur Aberkennung von Ehrungen.
- Der Fall Reiser ist kein Einzelfall; auch andere Persönlichkeiten der regionalen Kultur wie Kuno Brandauer und Hans Schmid wurden kritisch hinterfragt.
- Der Prozess der Aufarbeitung in Salzburg ist ein Beispiel für den oft jahrzehntelangen Kampf Österreichs mit seiner historischen Verantwortung.
Tobi Reiser: Volksmusik-Idol mit dunkler Seite
Tobias „Tobi“ Reiser der Ältere (1907–1974) gilt als einer der einflussreichsten Erneuerer der alpenländischen Volksmusik in der Nachkriegszeit. Mit der Gründung des Salzburger Adventsingens im Jahr 1946 schuf er eine Institution, die bis heute internationale Bekanntheit genießt und das Bild von Salzburg als Kulturstadt maßgeblich prägt. Seine Kompositionen und sein Wirken machten ihn zu einer Ikone der regionalen Identität.
Doch hinter der Fassade des traditionsbewussten Musikers verbarg sich eine tiefbraune Vergangenheit. Reiser war bereits vor dem „Anschluss“ Österreichs 1938 ein illegaler Nationalsozialist. Er trat der SA und später der SS bei, wo er den Rang eines SS-Oberscharführers erreichte. Während des NS-Regimes war er aktiv an der ideologischen Ausrichtung der Volkskultur beteiligt und profitierte von seiner Nähe zur Macht.
Die Rolle im Nationalsozialismus
Historische Dokumente belegen, dass Tobi Reiser nicht nur ein Mitläufer, sondern ein überzeugter Anhänger des Nationalsozialismus war. Seine Musik und seine organisatorische Arbeit dienten auch den Propagandazwecken des Regimes. Nach 1945 gelang es ihm, diese Vergangenheit weitgehend zu verschweigen und seine Karriere im Nachkriegsösterreich nahtlos fortzusetzen.
Die Aufdeckung durch die Medien
Obwohl Gerüchte über Reisers NS-Vergangenheit schon länger kursierten, wurde eine breite öffentliche Debatte erst durch journalistische Arbeit angestoßen. Insbesondere die „Salzburger Nachrichten“ (SN) spielten eine zentrale Rolle, indem sie immer wieder über die „braunen Flecken“ in den Biografien Salzburger Persönlichkeiten berichteten.
Ein entscheidender Bericht erschien bereits 2006, doch die gesellschaftliche Reaktion blieb zunächst verhalten. Der Prozess der Verabschiedung von einem liebgewonnenen Idol ist oft langwierig und von Widerständen geprägt. Viele Menschen taten sich schwer damit, die Verdienste Reisers für die Volkskultur von seiner politischen Vergangenheit zu trennen.
„Oft dauert es viele Jahre, bis sich die Gesellschaft von einzelnen ihrer Idole verabschiedet. Das ist auch in Salzburg nicht anders.“
Der wirkliche Wendepunkt kam erst später. Berichte, die neue Details und Dokumente präsentierten, erhöhten den öffentlichen Druck. Die Faktenlage wurde so erdrückend, dass ein Ignorieren nicht mehr möglich war. Dies zwang Politik und Kulturinstitutionen zum Handeln.
Konsequenzen der Enthüllungen
Die jahrelange journalistische Hartnäckigkeit führte schließlich zu konkreten Schritten. Die Stadt Salzburg reagierte auf die erdrückenden Beweise und leitete Maßnahmen zur Neubewertung von Ehrungen ein, die an Tobi Reiser und andere belastete Personen vergeben worden waren.
Zu den wichtigsten Konsequenzen gehörten:
- Umbenennung von Straßen: Der Tobi-Reiser-Platz in der Stadt Salzburg wurde umbenannt. Auch andere Gemeinden, in denen Straßen nach ihm benannt waren, folgten diesem Beispiel.
- Aberkennung von Preisen: Posthume Ehrungen wurden symbolisch aberkannt oder neu bewertet.
- Wissenschaftliche Aufarbeitung: Die Stadt Salzburg setzte eine Historikerkommission ein, die systematisch die Biografien von Personen untersuchte, nach denen Straßen benannt sind.
Historikerkommission als Instrument der Aufklärung
Die von der Stadt Salzburg eingesetzte Expertenkommission unter der Leitung des Historikers Oliver Rathkolb untersuchte die Biografien von hunderten Namensgebern Salzburger Straßen. Ihr Abschlussbericht lieferte eine fundierte wissenschaftliche Grundlage für politische Entscheidungen und trug maßgeblich zur Versachlichung der Debatte bei.
Kein Einzelfall: Das Erbe von Kuno Brandauer und Hans Schmid
Tobi Reiser war nicht die einzige Persönlichkeit der Salzburger Volkskultur mit einer NS-Vergangenheit. Die Recherchen der SN und anderer Medien brachten auch die Verstrickungen weiterer Personen ans Licht, darunter Kuno Brandauer und Hans Schmid.
Kuno Brandauer
Kuno Brandauer (1921–1987) war ein einflussreicher Volkskundler und langjähriger Leiter des Salzburger Heimatwerks. Er galt als Bewahrer von Tradition und Brauchtum. Auch seine Biografie wies jedoch eine Nähe zum Nationalsozialismus auf, was zu einer kritischen Neubewertung seiner Rolle führte.
Hans Schmid
Hans Schmid (1893–1987), ein Komponist und Kapellmeister, war ebenfalls eine prägende Figur der regionalen Musikszene. Seine Werke sind bis heute populär. Auch er war während der NS-Zeit aktiv und passte sich dem Regime an. Die Debatte um ihn zeigt, wie weit verbreitet die Verstrickungen in Kulturbetrieben waren.
Diese Fälle verdeutlichen ein Muster, das für ganz Österreich nach 1945 typisch war: Viele ehemalige Nationalsozialisten konnten ihre Karrieren ungehindert fortsetzen. Ihre NS-Vergangenheit wurde tabuisiert, während ihre kulturellen oder wissenschaftlichen Leistungen in den Vordergrund gestellt wurden. Es bedurfte einer neuen Generation von Journalisten und Historikern, um diese Schweigespirale zu durchbrechen.
Der lange Weg zur historischen Verantwortung
Der Umgang mit der NS-Vergangenheit von Tobi Reiser und anderen ist ein Lehrstück über die Mechanismen des kollektiven Verdrängens und die Bedeutung einer kritischen Öffentlichkeit. Der Prozess war schmerzhaft, da er das Selbstbild vieler Salzburgerinnen und Salzburger infrage stellte.
Die Auseinandersetzung ist jedoch ein Zeichen einer reiferen demokratischen Kultur. Sie zeigt die Bereitschaft, sich der eigenen Geschichte ohne Beschönigung zu stellen. Die Entscheidung, Straßen umzubenennen oder Ehrungen zu hinterfragen, ist kein Akt der Tilgung von Geschichte, sondern im Gegenteil: Es ist ein Akt der bewussten historischen Auseinandersetzung.
Auch wenn der Prozess in Salzburg langsam war, hat er doch eine nachhaltige Wirkung entfaltet. Er hat das Bewusstsein für die komplexen Biografien des 20. Jahrhunderts geschärft und deutlich gemacht, dass kulturelle Verdienste eine politische Vergangenheit nicht auslöschen können. Die Debatte ist noch nicht abgeschlossen und wird auch zukünftige Generationen beschäftigen.