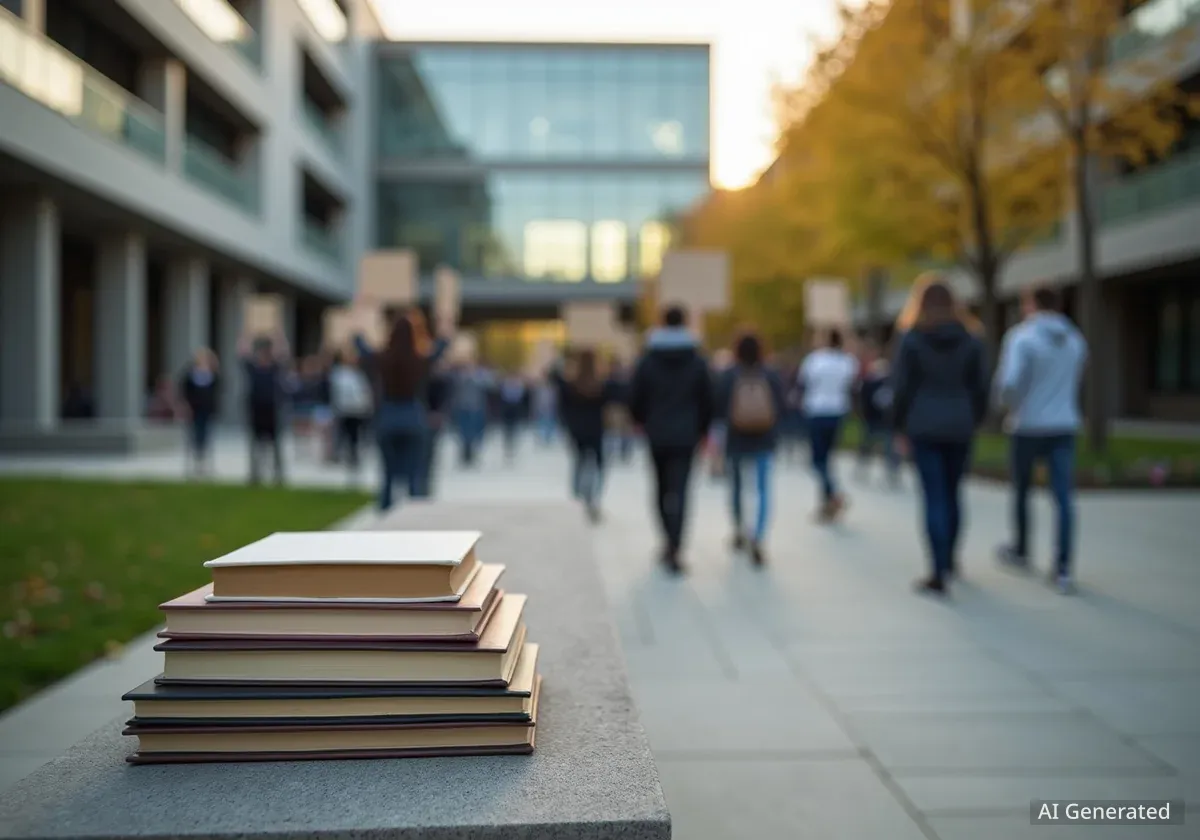An Österreichs Fachhochschulen wächst der Druck für einheitliche Arbeitsbedingungen. Die rund 9.000 Angestellten der 21 Fachhochschulen (FHs) fordern einen Kollektivvertrag, um Mindeststandards bei Gehältern und Arbeitsbedingungen festzulegen. Ohne eine solche Regelung bestehen derzeit erhebliche Lohnunterschiede zwischen den einzelnen Standorten.
Um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen, planen die Betriebsräte in der kommenden Woche eine Konferenz. Bereits am Dienstagmittag soll eine Protestaktion vor der FH Campus Wien auf die ungleiche Situation aufmerksam machen.
Das Wichtigste in Kürze
- Rund 9.000 Angestellte an 21 österreichischen Fachhochschulen sind ohne Kollektivvertrag (KV).
- Dies führt zu massiven Gehaltsunterschieden von bis zu 50 Prozent zwischen den Standorten.
- Ein bemerkenswertes West-Ost-Gefälle zeigt, dass westliche FHs oft schlechter zahlen als östliche.
- Die hohe Personalfluktuation wird als direkte Folge der ungleichen Bezahlung gesehen.
- Gewerkschaft und Betriebsräte fordern die FH-Eigentümer auf, einen Arbeitgeberverband für KV-Verhandlungen zu gründen.
Ein Sektor ohne einheitliche Regeln
Während für das Personal an öffentlichen Universitäten ein Kollektivvertrag selbstverständlich ist, fehlt eine solche Grundlage für den gesamten Fachhochschulsektor. Dies bedeutet, dass es keine verbindlichen Mindestgehälter, keine gemeinsamen Lohnverhandlungen und keine einheitlichen Regelungen für Arbeitszeiten oder andere Rahmenbedingungen gibt. Jede der 21 Fachhochschulen agiert hier eigenständig.
Diese Situation führt zu erheblichen Problemen, wie Kaja Unger, Professorin an der FH Johanneum in Graz, erklärt. Die fehlende Regulierung schaffe einen unfairen Wettbewerb zwischen den Einrichtungen und belaste die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Gehaltsunterschiede von bis zu 50 Prozent
Die konkreten Auswirkungen der fehlenden Standards sind gravierend. Christoph Zeiselberger von der Gewerkschaft GPA berichtet von extremen Fällen. „Wir haben Fachhochschulen, wo eine Lehrperson um 50 Prozent weniger verdient als eine vergleichbare Lehrperson in einer anderen Fachhochschule“, so Zeiselberger. Diese Diskrepanz sei nicht länger tragbar.
Besonders auffällig ist laut Kaja Unger ein sogenanntes West-Ost-Gefälle. Anders als oft vermutet, zahlen die Fachhochschulen im Westen Österreichs tendenziell schlechter als jene im Osten des Landes. „Die Gehaltsunterschiede sind sehr groß. Wir haben ein massives West-Ost-Gefälle, aber nicht in dem Fall, dass der Osten schlechter zahlt als der Westen, sondern dass der Westen schlechter zahlt als der Osten“, stellt Unger fest.
Fakten zur Situation
- Betroffene Mitarbeiter: ca. 9.000
- Anzahl der FHs: 21
- Maximaler Gehaltsunterschied: bis zu 50 %
- Status: Kein Kollektivvertrag für den Sektor
Folgen für Lehre und Personal
Die ungleichen Gehälter haben direkte Konsequenzen für die Stabilität des Lehrkörpers. Viele Lehrende sind gezwungen, den Arbeitsplatz zu wechseln, sobald sich an einer anderen Fachhochschule eine finanziell bessere Möglichkeit bietet. Dies führt zu einer hohen Personalfluktuation.
Eine hohe Fluktuation erschwert den Aufbau langfristiger Forschungsprojekte und beeinträchtigt die Kontinuität in der Lehre. Studierende leiden ebenfalls darunter, wenn erfahrene Lehrende die Institution verlassen, weil die Rahmenbedingungen an einem anderen Standort attraktiver sind. Die Stabilität des Personals ist ein wichtiger Faktor für die Qualität der Ausbildung.
„Die Fluktuation der Lehrenden ist dadurch höher, weil viele wechseln würden, wenn sie woanders ein besseres Angebot erhalten.“
Der Ruf nach einem Arbeitgeberverband
Um überhaupt Verhandlungen über einen Kollektivvertrag aufnehmen zu können, ist ein zentraler Ansprechpartner auf Arbeitgeberseite notwendig. Die Gewerkschaft GPA appelliert daher an die Träger und Eigentümer der Fachhochschulen, sich zu einem gemeinsamen Arbeitgeberverband zusammenzuschließen.
Christoph Zeiselberger betont die Wichtigkeit eines freiwilligen Prozesses: „Unser großer Wunsch ist, dass sich die Arbeitgeber freiwillig auf den Verhandlungstisch mit uns setzen. Die Freiwilligkeit ist uns wichtig, weil dann passieren die besseren Ergebnisse.“ Ein gemeinsamer Verhandlungspartner würde den Weg für konstruktive Gespräche ebnen.
Hintergrund: Kollektivvertrag in Österreich
Ein Kollektivvertrag (KV) ist eine schriftliche Vereinbarung zwischen einer Arbeitgebervertretung (z.B. Wirtschaftskammer) und einer Arbeitnehmervertretung (z.B. Gewerkschaft). Er regelt branchenweit wichtige Rechte und Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis, wie Mindestlöhne, Arbeitszeiten, Kündigungsfristen und Urlaubsansprüche. Er schafft faire und transparente Wettbewerbsbedingungen.
Politik in der Verantwortung
Neben den Eigentümern der Fachhochschulen sehen einige Akteure auch die Politik in der Pflicht. Der Bildungssektor wird zu einem großen Teil aus öffentlichen Mitteln finanziert. Daher müsse der Staat ein Interesse an fairen und gleichen Bedingungen haben.
Kaja Unger vertritt hierzu eine klare Meinung. Sie sieht die Verantwortung bei den politischen Entscheidungsträgern. „Meine höchstpersönliche Meinung ist, dass die Politik dafür verantwortlich ist, dass die Bildung in Österreich einen gleichwertigen Standard in allen Sektoren hat“, so die Professorin. Ein einheitlicher Standard sei entscheidend für die Qualität und Gerechtigkeit im gesamten österreichischen Bildungssystem.
Die kommenden Proteste und die Betriebsrätekonferenz sollen den Druck auf alle Beteiligten erhöhen, um endlich eine Lösung für die rund 9.000 Angestellten zu finden und den Fachhochschulsektor auf eine stabile und faire Grundlage zu stellen.