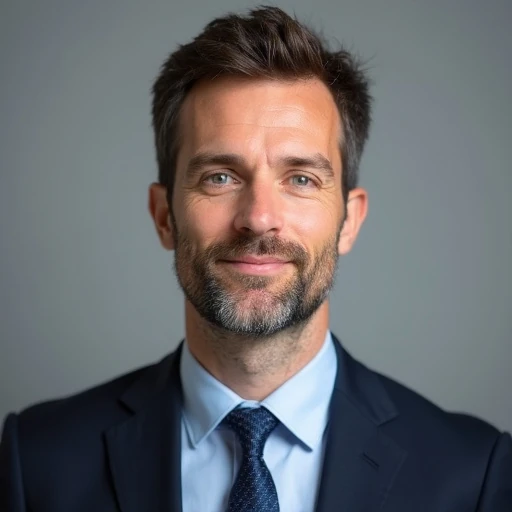Salzburgs Landwirte und Gartenbesitzer blicken mit wachsender Sorge nach Tirol. Dort wurde der Japankäfer, ein aus Ostasien stammender Schädling, nur rund 50 Kilometer von der Salzburger Landesgrenze entfernt nachgewiesen. Eine Etablierung des Insekts in der Region könnte weitreichende wirtschaftliche und ökologische Folgen haben, da er eine enorme Bandbreite an Pflanzen befällt.
Das Wichtigste in Kürze
- Nähe zu Salzburg: Ein Japankäfer wurde im Tiroler Bezirk Kufstein nachgewiesen, nur 50 Kilometer von Salzburg entfernt.
- Große Gefahr: Das Insekt bedroht über 400 Pflanzenarten, darunter Obstbäume, Weinreben, landwirtschaftliche Kulturen und Rasenflächen.
- Wirtschaftlicher Schaden: Sowohl der Käfer als auch seine Larven verursachen massive Schäden, was zu erheblichen Ernteausfällen führen kann.
- Bekämpfung schwierig: Derzeit gibt es keine zugelassenen Pflanzenschutzmittel gegen den Japankäfer in Österreich.
- Meldepflicht: Jede Sichtung des Schädlings muss umgehend den Behörden gemeldet werden, um eine Ausbreitung zu verhindern.
Ein invasiver Schädling an der Landesgrenze
Die Nachricht löste bei den heimischen Behörden und Landwirten umgehend Reaktionen aus. Mitte September 2025 entdeckte der Tiroler Pflanzenschutzdienst in der Gemeinde Angath ein Exemplar des Japankäfers (Popillia japonica) in einer Lockstofffalle. Dieser Fund ist besonders besorgniserregend, da er die fortschreitende Ausbreitung des Schädlings in Österreich bestätigt. Bereits Ende Juli wurde ein erstes Exemplar in Vorarlberg gemeldet.
Die geografische Nähe des Tiroler Fundortes zu Salzburg ist der Hauptgrund für die erhöhte Alarmbereitschaft. Experten befürchten, dass der Käfer durch den Waren- und Personenverkehr, beispielsweise als „blinder Passagier“ in Fahrzeugen, unbemerkt die Landesgrenze überqueren könnte. Um dies zu verhindern, wurden bereits vorbeugende Maßnahmen ergriffen.
Überwachung entlang der Verkehrswege
In Salzburg hat man reagiert und entlang der Hauptverkehrsadern, insbesondere der Autobahnen, spezielle Lockfallen aufgestellt. Der Fokus liegt dabei auf Raststätten und Parkplätzen, da diese als typische Umschlagplätze für eingeschleppte Arten gelten. Ziel ist es, eine mögliche Einschleppung so früh wie möglich zu erkennen und eine dauerhafte Ansiedlung des Käfers zu unterbinden.
Was ist ein Quarantäneschädling?
Der Japankäfer wird in der Europäischen Union als prioritärer Quarantäneschädling eingestuft. Das bedeutet, er stellt eine erhebliche Gefahr für die Pflanzenwelt und die Landwirtschaft dar und ist in der EU noch nicht weit verbreitet. Für solche Schädlinge gelten strenge Überwachungs- und Bekämpfungsmaßnahmen, um ihre Etablierung und Ausbreitung zu verhindern. Dazu gehört auch eine gesetzlich verankerte Meldepflicht für jeden Fund.
Die enorme Zerstörungskraft des Japankäfers
Die Sorge vor dem Japankäfer ist gut begründet. Das Insekt zeichnet sich durch einen außergewöhnlich großen Appetit aus und ist wenig wählerisch bei seiner Nahrung. Laut Experten frisst der Käfer an Blättern, Blüten und Früchten von über 400 verschiedenen Pflanzenarten. Bei einem Massenauftreten kann es zu einem kompletten Kahlfraß kommen.
Johann Schmid von der Landwirtschaftskammer Salzburg warnt eindringlich vor den potenziellen Folgen. Er beschreibt die Situation drastisch:
„Lasse sich ein Schwarm in Salzburg nieder, dann sei dort kein Blatt mehr sicher.“
Diese Aussage verdeutlicht das Ausmaß der Bedrohung für die heimische Landwirtschaft und den Gartenbau. Betroffen wären nicht nur professionelle Betriebe, sondern auch private Gärten und öffentliche Grünflächen.
Ein breites Nahrungsspektrum
Zu den bevorzugten Wirtspflanzen des Japankäfers gehören unter anderem:
- Obstbäume: Apfel, Kirsche, Marille, Pfirsich
- Beerensträucher: Himbeeren, Brombeeren
- Weinreben: Blätter und Trauben
- Feldfrüchte: Mais, Soja
- Laubbäume: Ahorn, Linde, Eiche
- Zierpflanzen: Rosen
Schäden auch unter der Erde
Nicht nur der erwachsene Käfer richtet Schaden an. Auch seine Larven, die sogenannten Engerlinge, sind eine ernsthafte Bedrohung. Sie leben im Boden und ernähren sich von den Wurzeln von Gräsern und krautigen Pflanzen. Dies führt zu einer Schwächung der Pflanzen und kann bei Rasen- und Wiesenflächen zu großflächigen, braunen und abgestorbenen Stellen führen. Die Grasnarbe löst sich vom Untergrund und kann wie ein Teppich abgehoben werden. Insbesondere für die Grünlandwirtschaft und Sportplätze stellt dies ein erhebliches Problem dar.
Herausforderungen bei der Bekämpfung
Sollte sich der Japankäfer in Salzburg ansiedeln, stehen die Verantwortlichen vor einer großen Herausforderung. Laut Johann Schmid von der Landwirtschaftskammer gibt es derzeit kein einziges in Österreich zugelassenes Pflanzenschutzmittel, das eine wirksame und schnelle Bekämpfung des Käfers ermöglicht. Dies erschwert die Situation erheblich und macht Prävention zur wichtigsten Strategie.
„Deshalb geht es darum, das Fallgebiet so klein wie möglich zu halten“, erklärt Schmid. Die Eindämmung ist der zentrale Punkt im Notfallplan. Wird ein Befall festgestellt, wird eine abgegrenzte Zone eingerichtet, in der strenge Maßnahmen gelten. Dazu können Transportverbote für Pflanzen und Erde gehören, um eine weitere Verschleppung zu verhindern. Die Bekämpfung selbst stützt sich auf eine Kombination aus dem massenhaften Aufstellen von Fallen und, wo möglich, dem Einsatz von natürlichen Gegenspielern wie bestimmten Pilzen oder Nematoden.
Meldepflicht: Jeder Fund zählt
Aufgrund der großen Gefahr ist die Mithilfe der Bevölkerung entscheidend. Der Japankäfer ist in ganz Österreich streng meldepflichtig. Jede verdächtige Sichtung muss sofort dem amtlichen Pflanzenschutzdienst des jeweiligen Bundeslandes oder der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) gemeldet werden. Eine schnelle Meldung ist entscheidend, um die Ausbreitung frühzeitig stoppen zu können.
So erkennen Sie den Japankäfer
Um eine Verwechslung mit heimischen Käfern wie dem Gartenlaubkäfer oder dem Rosenkäfer zu vermeiden, ist es wichtig, die charakteristischen Merkmale des Japankäfers zu kennen:
- Größe: Erwachsene Käfer sind etwa 8 bis 12 Millimeter lang und 6 Millimeter breit.
- Farbe: Der Kopf und der Halsschild schimmern auffällig grün-metallisch. Die Flügeldecken sind kupferbraun.
- Haarbüschel: Das eindeutigste Erkennungsmerkmal sind kleine weiße Haarbüschel. An jeder Seite des Hinterleibs befinden sich fünf solcher Büschel, zusätzlich gibt es zwei weitere, deutlich sichtbare Büschel am letzten Segment des Hinterleibs.
Bürger werden gebeten, bei einem Verdacht ein Foto des Insekts zu machen und den Fundort genau zu notieren. Meldungen können online über die Webseite der AGES eingereicht werden. Es wird ausdrücklich davor gewarnt, den Käfer selbst zu transportieren, um eine unbeabsichtigte Verbreitung zu vermeiden.