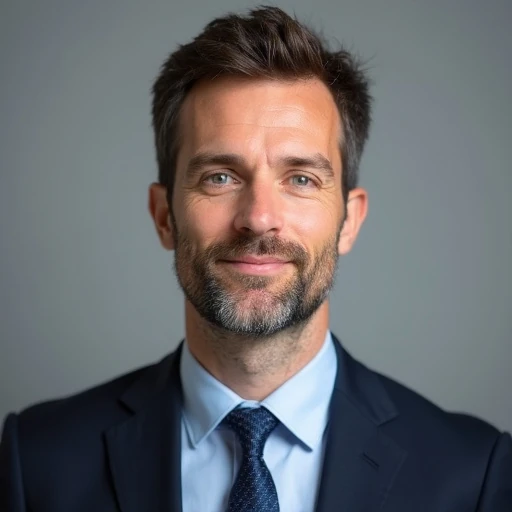Heinrich Dieter Kiener, der seit Ende 1990 die Stiegl-Brauerei leitet, äußert sich besorgt über den Zustand des gesellschaftlichen Dialogs. Anlässlich der 30-jährigen Nachbarschaft mit den Salzburger Nachrichten betont der Unternehmer die Notwendigkeit, wieder mehr miteinander ins Gespräch zu kommen und die Bedeutung von konstruktiver Kritik anzuerkennen.
Das Wichtigste in Kürze
- Heinrich Dieter Kiener, Eigentümer der Stiegl-Brauerei, kritisiert den Verfall der Gesprächskultur in der Gesellschaft.
- Seit über 30 Jahren sind die Brauerei und das Medienhaus Salzburger Nachrichten direkte Nachbarn in Maxglan.
- Kiener betont die Wichtigkeit von guter Nachbarschaft, die über räumliche Nähe hinausgeht und sozialen Austausch beinhaltet.
- Als kritischer Medienkonsument unterstreicht er die Notwendigkeit eines unabhängigen und fundierten Journalismus.
Eine besondere Nachbarschaft in Salzburg
Seit drei Jahrzehnten teilen sich zwei prägende Salzburger Institutionen eine direkte Nachbarschaft im Stadtteil Maxglan: die Stiegl-Brauerei zu Salzburg und das Medienhaus der Salzburger Nachrichten. Für Stiegl-Eigentümer Heinrich Dieter Kiener ist dies mehr als nur eine geografische Gegebenheit. Es ist ein Symbol für das Zusammenleben und den Austausch in einer Gemeinschaft.
"Nachbarschaft heißt für mich räumliche Nähe, das heißt auch Austausch zwischen unseren Häusern, der schon ganz gut stattfindet", erklärt Kiener. Er sieht Nachbarschaft als ein soziales Prinzip, das auf Kommunikation und gegenseitigem Verständnis beruht. In einer Zeit, in der die digitale Kommunikation oft den persönlichen Kontakt ersetzt, gewinnt die physische Nähe an Bedeutung.
Ein Salzburger Wahrzeichen
Die Stiegl-Brauerei ist die größte Privatbrauerei Österreichs und wurde bereits 1492 gegründet. Heinrich Dieter Kiener übernahm die Leitung des Familienunternehmens Ende 1990 und hat es seither maßgeblich geprägt und modernisiert, ohne die traditionellen Wurzeln zu vernachlässigen.
Sorge um die gesellschaftliche Gesprächskultur
Im Zentrum von Kieners Überlegungen steht eine tiefgreifende Sorge um die Art und Weise, wie in der heutigen Gesellschaft kommuniziert wird. Seine zentrale These lautet: "Wir haben verlernt, miteinander zu reden." Diese Beobachtung bezieht sich auf eine zunehmende Polarisierung und die abnehmende Fähigkeit, andere Meinungen anzuhören und konstruktiv zu diskutieren.
Kiener sieht die Gefahr, dass der respektvolle Austausch durch Konfrontation und Monologe ersetzt wird. Anstatt zuzuhören und zu versuchen, den Standpunkt des anderen zu verstehen, verharren viele Menschen in ihren eigenen Echokammern. Dies erschwert die Lösungsfindung für komplexe gesellschaftliche Herausforderungen.
"Es geht darum, wieder eine Kultur des Zuhörens zu etablieren. Nur wenn wir bereit sind, uns auf die Argumente anderer einzulassen, können wir als Gesellschaft vorankommen."
Die Ursachen des Problems
Die Gründe für diese Entwicklung sind vielfältig. Soziale Medien fördern oft kurze, emotionale und zugespitzte Aussagen anstelle von differenzierten Diskussionen. Algorithmen verstärken bestehende Meinungen und schirmen Nutzer von gegenteiligen Ansichten ab. Dies führt zu einer Fragmentierung der Öffentlichkeit.
Gleichzeitig, so die Beobachtung, nimmt der direkte, persönliche Kontakt ab. Gespräche im Freundeskreis, am Stammtisch oder eben auch zwischen Nachbarn, die früher zum Ausgleich von Meinungsverschiedenheiten beitrugen, werden seltener. Kiener plädiert dafür, diese Form des direkten Austauschs wiederzubeleben.
Die Rolle der Medien in einer polarisierten Welt
Als langjähriger Unternehmer und Nachbar eines großen Medienhauses hat Heinrich Dieter Kiener eine klare Vorstellung von der Rolle des Journalismus. Er bezeichnet sich selbst als kritischen Medienkonsumenten, der hohe Ansprüche an die Qualität der Berichterstattung stellt. Für ihn ist ein unabhängiger und sorgfältig recherchierender Journalismus ein unverzichtbarer Pfeiler der Demokratie.
Medien haben die Aufgabe, Fakten zu liefern, Hintergründe zu beleuchten und verschiedene Perspektiven darzustellen. Sie sollen nicht nur informieren, sondern auch den gesellschaftlichen Diskurs anregen und moderieren. Dies erfordert Mut zur Kritik, aber auch Fairness und Ausgewogenheit.
Unternehmer und Medienkonsument
Heinrich Dieter Kiener leitet die Stiegl-Brauerei in fünfter Generation der Familie Kiener. Sein unternehmerisches Handeln ist von Nachhaltigkeit und regionaler Verantwortung geprägt. Seine Perspektive auf die Medien ist die eines Bürgers und Wirtschaftsakteurs, der auf verlässliche Informationen angewiesen ist.
Kritik als Chance begreifen
Kiener betont, dass Kritik nichts Negatives sein muss. Im Gegenteil: Fundierte und konstruktive Kritik ist für Unternehmen wie auch für die Gesellschaft als Ganzes eine Chance zur Weiterentwicklung. "Kritikfähigkeit ist eine Stärke", so der Unternehmer. Es sei wichtig, Kritik nicht als persönlichen Angriff zu werten, sondern als Anregung, Dinge zu überdenken und zu verbessern.
Diese Haltung wünscht er sich auch für den öffentlichen Diskurs. Anstatt kritische Stimmen sofort abzuwehren, sollte man ihre Argumente prüfen. Dies ist ein wesentlicher Bestandteil einer gesunden Debattenkultur, die er derzeit in vielen Bereichen vermisst.
Ein Appell für die Zukunft
Die Gedanken von Heinrich Dieter Kiener sind mehr als nur eine Reflexion über eine 30-jährige Nachbarschaft. Sie sind ein Appell an die gesamte Gesellschaft, die Grundlagen des Zusammenlebens neu zu bewerten. Sein Wunsch ist es, dass die Menschen wieder mehr aufeinander zugehen – im Kleinen wie im Großen.
Dazu gehört:
- Aktives Zuhören: Dem Gegenüber aufmerksam zuhören, anstatt nur auf eine Gelegenheit zum Sprechen zu warten.
- Respektvoller Umgang: Auch bei Meinungsverschiedenheiten einen sachlichen und respektvollen Ton wahren.
- Offenheit für andere Perspektiven: Die Bereitschaft zeigen, die eigene Position zu hinterfragen.
- Persönliche Begegnung fördern: Den direkten Austausch suchen, um Missverständnisse zu reduzieren.
Letztendlich, so die Botschaft des Stiegl-Eigentümers, beginnt die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts im Kleinen – zum Beispiel in einer guten Nachbarschaft. Wenn es dort gelingt, im Gespräch zu bleiben, ist das ein wichtiger Schritt für die gesamte Gemeinschaft.