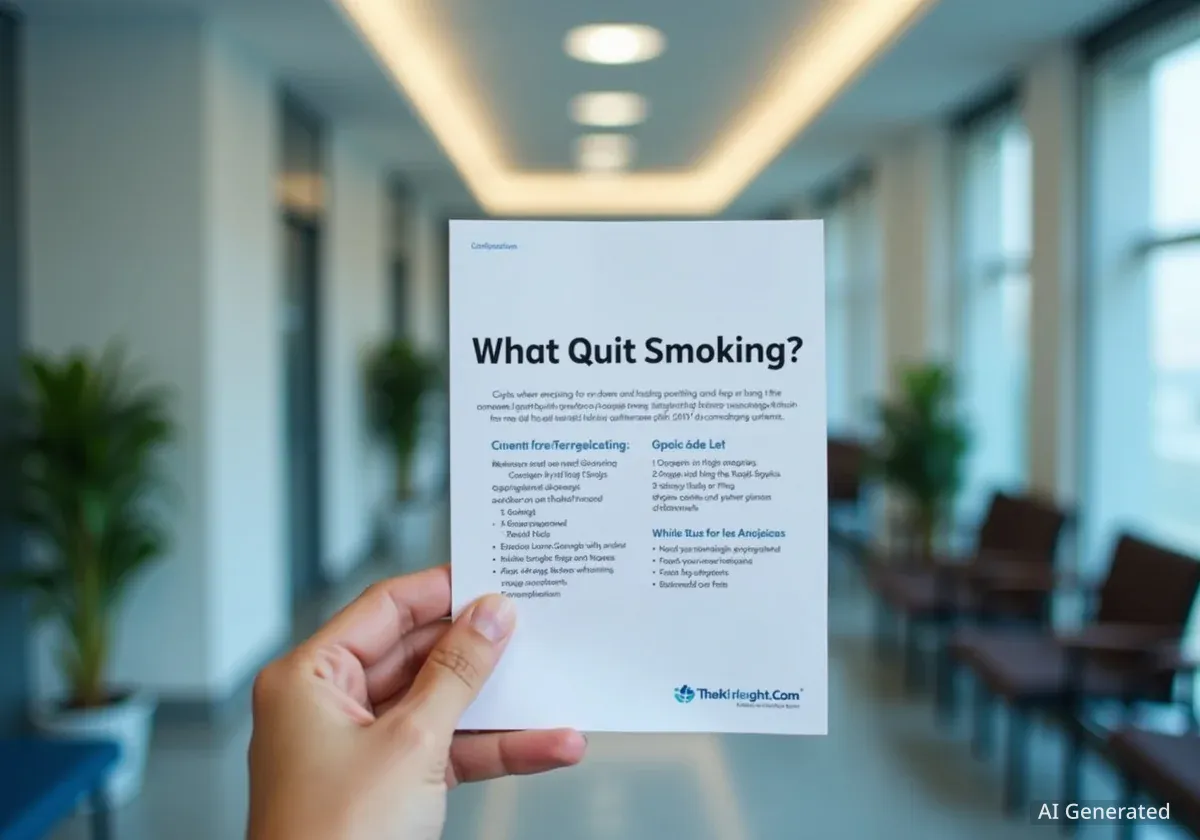Drei Jahre nach der gesetzlichen Neuregelung des assistierten Suizids in Österreich stößt die Umsetzung in Salzburg weiterhin auf erhebliche Hürden. Für unheilbar kranke Menschen, die sich für ein selbstbestimmtes Lebensende entscheiden, gestaltet sich der Weg oft schwierig, da nur eine kleine Zahl von Ärzten, Notaren und Apotheken bereit ist, sie zu begleiten.
Das Wichtigste in Kürze
- In Salzburg nehmen jährlich etwa zehn Personen eine Sterbeverfügung in Anspruch.
- Nur 22 Arztpraxen im gesamten Bundesland führen die notwendigen Aufklärungsgespräche durch.
- Die Mehrheit der Ärzteschaft sieht den assistierten Suizid als unvereinbar mit ihrem Berufsethos an.
- Ein Drittel der Notariate und Apotheken in Salzburg ist bereit, den Prozess zu unterstützen.
Ein Weg mit vielen Hindernissen
Für Patienten mit einer unheilbaren Krankheit, die den Wunsch haben, ihr Leben selbstbestimmt zu beenden, ist der Prozess in Salzburg komplex. Die gesetzlichen Vorgaben sehen einen mehrstufigen Ablauf vor, um sicherzustellen, dass die Entscheidung frei von äußerem Druck und bei voller Urteilsfähigkeit getroffen wird. Doch die praktische Umsetzung scheitert oft an der geringen Zahl an Fachleuten, die zur Mitwirkung bereit sind.
Im gesamten Bundesland Salzburg stehen lediglich 22 Arztpraxen für die gesetzlich vorgeschriebenen Aufklärungsgespräche zur Verfügung. Viele Mediziner lehnen eine Beteiligung aus ethischen Gründen ab. Sie sehen einen Widerspruch zu ihrem Auftrag, Leben zu erhalten und Leiden zu lindern.
Die Perspektive eines Arztes
Einer der wenigen Ärzte, die diese Gespräche führen, ist der Allgemeinmediziner Richard Barta aus Salzburg-Itzling. Er betont die Wichtigkeit einer sorgfältigen Prüfung jedes Einzelfalls. Barta berichtet, dass er bereits eine Sterbeverfügung ablehnen musste, weil noch Heilungschancen bestanden. Druck von Angehörigen habe er bisher nicht erlebt.
„Oft sind diese Patienten von einer langen Krankheitsgeschichte und einem großen Leiden betroffen. Der Tod wird da als Erlösung gesehen.“ – Dr. Richard Barta, Allgemeinmediziner
Seine Erfahrung zeigt, dass die Betroffenen meist eine lange Leidensgeschichte hinter sich haben und ihre Entscheidung wohlüberlegt treffen. Die Aufgabe des Arztes sei es, die Entscheidungsfähigkeit und die medizinischen Voraussetzungen objektiv zu prüfen.
Der gesetzliche Ablauf einer Sterbeverfügung
Das Verfahren zur Errichtung einer Sterbeverfügung ist streng geregelt, um Missbrauch zu verhindern. Es umfasst mehrere Schritte:
- Ärztliche Aufklärung: Zwei unabhängige Ärzte müssen den Patienten aufklären. Einer davon muss eine Qualifikation in Palliativmedizin besitzen.
- Bestätigung: Die Ärzte müssen bestätigen, dass die Person entscheidungsfähig ist, an einer unheilbaren Krankheit leidet und die Entscheidung freiwillig trifft.
- Bedenkzeit: Nach der ärztlichen Aufklärung muss eine Frist von mehreren Wochen verstreichen, um die Entscheidung zu überdenken.
- Notarielle Errichtung: Ein Notar oder ein Patientenanwalt errichtet die eigentliche Sterbeverfügung. Auch hier wird der freie Wille des Patienten geprüft.
- Bezug des Präparats: Mit der Verfügung kann in einer Apotheke ein tödliches Präparat (Natrium-Pentobarbital) bezogen werden.
Die Rolle von Notaren und Apotheken
Auch bei Notaren und Apotheken gab es anfangs große Zurückhaltung. Mittlerweile hat sich die Situation etwas entspannt, auch wenn noch lange nicht alle mitwirken. In Salzburg ist heute etwa jeder dritte Notar bereit, eine Sterbeverfügung zu beurkunden. Ihre Aufgabe ist es, nochmals zu prüfen, ob die Entscheidung frei und ohne Zwang getroffen wird.
Ähnlich sieht es bei den Apotheken aus. Rund ein Drittel der Apotheken im Bundesland würde das entsprechende Präparat abgeben. Die Abgabe ist jedoch weit mehr als ein reiner Verkaufsvorgang. Sie ist mit intensiven Gesprächen verbunden.
Intensive Beratung in der Apotheke
Die Apothekerin Stefanie Stelzig beschreibt den Austausch mit den Betroffenen als sehr tiefgehend. Die Fragen seien sehr persönlich und praktisch. „Wir haben wirklich oft einen sehr intensiven Austausch mit den Personen“, erklärt sie.
Manche Patienten möchten wissen, was passiert, wenn Angehörige im letzten Moment doch die Rettung rufen. Andere fragen, ob sie vor der Einnahme noch ein Glas Wein trinken dürfen. Diese Gespräche verdeutlichen die emotionale Last, die auf allen Beteiligten liegt.
Alternative Wege und die Bedeutung der Palliativversorgung
Experten betonen, dass der Wunsch zu sterben nicht immer endgültig ist. Oftmals kann eine gute medizinische, soziale und pflegerische Versorgung die Lebensqualität so weit verbessern, dass der Todeswunsch wieder in den Hintergrund tritt. Irmgard Singh, ärztliche Leiterin im Lebensraum Tageshospiz, berichtet von einem Patienten, dessen Todeswunsch nach einer erfolgreichen Schmerztherapie verschwand. „Er hat dann zu mir gesagt, dass es ihm zum ersten Mal seit drei Jahren wieder so gut geht, dass er wieder Spaß am Leben hat“, so Singh. Dies unterstreicht die zentrale Rolle der Palliativmedizin als Alternative zum assistierten Suizid.
Ein gesellschaftlicher Konsens in Entwicklung
Drei Jahre nach der Gesetzesänderung ist der Umgang mit dem assistierten Suizid in Salzburg noch immer ein sensibles Thema. Die Ärztekammer, Apothekerkammer und Notariatskammer betonen auf Anfrage, dass der Prozess im Bundesland gut geregelt sei. Dennoch zeigt die Praxis, dass die geringe Zahl an mitwirkenden Fachleuten eine große Herausforderung für Betroffene darstellt.
Der Konsens unter den Beteiligten lautet, dass die Freiwilligkeit an oberster Stelle stehen muss – nicht nur für den Patienten, sondern auch für die Ärzte, Notare und Apotheker, die den Prozess begleiten. Die Angst, Fehler zu machen, sei zwar groß, nehme aber langsam ab. Die Debatte über ein selbstbestimmtes Lebensende und die dafür notwendigen Rahmenbedingungen wird die Gesellschaft in Salzburg wohl noch länger beschäftigen.
Hilfe in Krisensituationen
Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Krise befinden, gibt es professionelle und anonyme Hilfsangebote. Zögern Sie nicht, diese in Anspruch zu nehmen.
- Telefonseelsorge: 142 (rund um die Uhr, kostenlos)
- Rat auf Draht (für Jugendliche): 147
- Krisenhotline Pro Mente Salzburg: 0662 433351
- Krisenhotline Pro Mente St. Johann: 06412 20033
- Krisenhotline Pro Mente Zell am See: 06542 72600