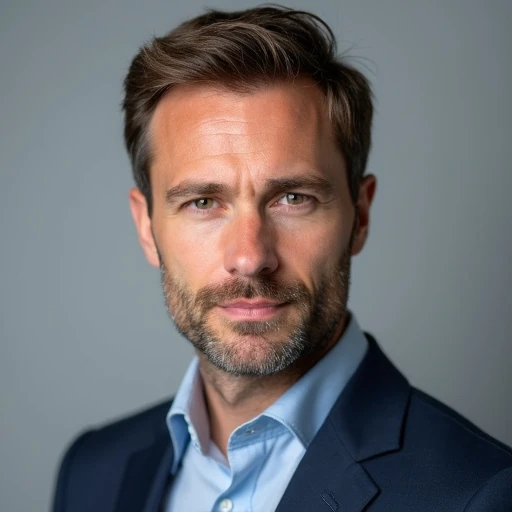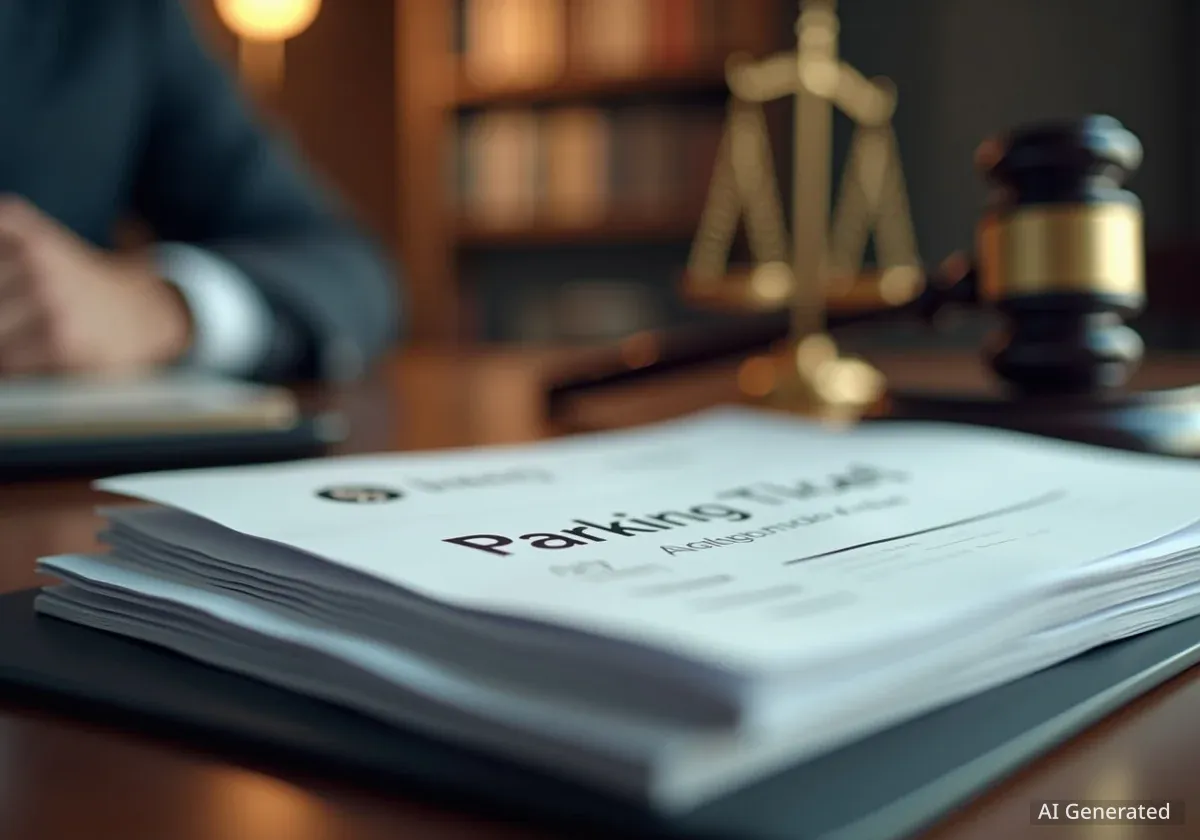Nach einem schockierenden Angriff auf eine Pensionistin am Lieferinger Friedhof im Juli wurde der mutmaßliche Täter nun für nicht schuldfähig erklärt. Ein psychiatrisches Gutachten diagnostizierte bei dem 42-jährigen Mann paranoide Schizophrenie. Er wird daher nicht in einem regulären Strafverfahren verurteilt, sondern in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen.
Der Vorfall, bei dem eine ältere Dame in einer Gerätehütte am Friedhofsrand attackiert wurde und Todesängste ausstand, hatte in der Salzburger Bevölkerung für große Beunruhigung gesorgt. Die Entscheidung des Gerichts wirft nun ein Schlaglicht auf den Umgang der Justiz mit psychisch kranken Straftätern.
Das Wichtigste in Kürze
- Ein 42-jähriger Mann, der im Juli eine Pensionistin am Lieferinger Friedhof angriff, wurde für unzurechnungsfähig erklärt.
- Ein psychiatrisches Gutachten bestätigt eine Erkrankung an paranoider Schizophrenie.
- Der Mann wird nicht zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, sondern in den Maßnahmenvollzug eingewiesen.
- Die Entscheidung basiert auf dem Grundsatz, dass nur schuldfähige Personen bestraft werden können.
Der Vorfall am Lieferinger Friedhof
An einem Sommertag im Juli ereignete sich die Tat, die das Leben einer Salzburger Pensionistin nachhaltig prägte. Die Frau besuchte das Grab ihrer Eltern auf dem Friedhof in Liefering, um es zu pflegen. Als sie anschließend in einer kleinen Hütte am Rande des Geländes Unkraut entsorgen wollte, wurde sie unerwartet von einem Mann angegriffen.
Die Situation eskalierte schnell. Der Angreifer versetzte die Frau in Panik. Sie erlebte Momente, die sie später als pure Todesangst beschrieb. Der Täter handelte unvorhersehbar und aggressiv. Erst nach einiger Zeit gelang es dem Opfer, sich aus der bedrohlichen Lage zu befreien und Hilfe zu holen. Die Polizei konnte den Verdächtigen, einen 42-jährigen Mann, kurz darauf festnehmen.
Traumatische Folgen für das Opfer
Für die betroffene Pensionistin waren die Erlebnisse zutiefst traumatisierend. Ein Ort der stillen Trauer und des Gedenkens wurde für sie zu einem Schauplatz des Schreckens. Solche Ereignisse können langanhaltende psychische Folgen haben, darunter Angstzustände, Schlafstörungen und das Gefühl ständiger Unsicherheit. Die Verarbeitung eines derartigen Angriffs ist oft ein langwieriger Prozess, der professionelle Unterstützung erfordert.
Gerichtliche Entscheidung und psychiatrisches Gutachten
Im Zuge der Ermittlungen ordnete die Staatsanwaltschaft Salzburg ein psychiatrisches Gutachten an, um die Zurechnungsfähigkeit des 42-jährigen Beschuldigten zu klären. Dies ist ein Standardverfahren bei Straftaten, bei denen Zweifel an der psychischen Verfassung des Täters bestehen.
Das Ergebnis des Gutachtens war eindeutig: Der Mann leidet an einer schweren psychischen Erkrankung, konkret an paranoider Schizophrenie. Zum Zeitpunkt der Tat war er aufgrund seiner Krankheit nicht in der Lage, das Unrecht seines Handelns zu erkennen oder entsprechend dieser Einsicht zu handeln. Juristisch ausgedrückt, war er nicht schuldfähig.
Was bedeutet „nicht schuldfähig“?
Im österreichischen Strafrecht gilt der Grundsatz „Keine Strafe ohne Schuld“. Eine Person gilt als schuldunfähig (oder unzurechnungsfähig), wenn sie zum Zeitpunkt der Tat aufgrund einer Geisteskrankheit, einer geistigen Behinderung, einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung oder einer gleichwertigen seelischen Störung nicht fähig ist, das Unrecht ihrer Tat einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln. In solchen Fällen erfolgt keine Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe, sondern die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher, den sogenannten Maßnahmenvollzug.
Diese Diagnose hat weitreichende Konsequenzen für das weitere Verfahren. Anstatt einer Anklage wegen eines Delikts wie schwerer Nötigung oder Körperverletzung und einer anschließenden Gefängnisstrafe beantragte die Staatsanwaltschaft die Unterbringung des Mannes im Maßnahmenvollzug.
Der Maßnahmenvollzug als Konsequenz
Die Entscheidung für eine Einweisung in den Maßnahmenvollzug bedeutet nicht, dass der Täter straffrei ausgeht. Vielmehr handelt es sich um eine spezialisierte Form der Unterbringung, die zwei Hauptziele verfolgt: den Schutz der Allgemeinheit vor weiteren gefährlichen Taten und die therapeutische Behandlung des Betroffenen.
Der Aufenthalt in einer solchen Anstalt ist im Gegensatz zu einer regulären Haftstrafe zeitlich unbefristet. Die Entlassung hängt allein vom Therapiefortschritt und der Einschätzung der behandelnden Ärzte und Gutachter ab. Eine Freilassung erfolgt nur dann, wenn keine Gefahr mehr von der Person ausgeht.
- Sicherheit: Die Untergebrachten werden in gesicherten Einrichtungen betreut, um die Öffentlichkeit zu schützen.
- Therapie: Ein Team aus Ärzten, Psychologen und Therapeuten arbeitet daran, die psychische Erkrankung zu behandeln.
- Regelmäßige Überprüfung: Gerichte überprüfen in regelmäßigen Abständen, ob die Voraussetzungen für die Anhaltung weiterhin gegeben sind.
Paranoide Schizophrenie: Eine ernste Erkrankung
Die paranoide Schizophrenie ist eine Form der Schizophrenie, bei der Wahnvorstellungen und Halluzinationen im Vordergrund stehen. Betroffene können unter Verfolgungswahn leiden und das Gefühl haben, dass sich andere gegen sie verschworen haben. Die Realitätswahrnehmung ist stark beeinträchtigt, was zu unvorhersehbarem und für Außenstehende nicht nachvollziehbarem Verhalten führen kann.
Ein Dilemma für die Gesellschaft
Fälle wie dieser stellen die Gesellschaft und das Justizsystem vor eine große Herausforderung. Einerseits steht das tief empfundene Leid des Opfers und das Bedürfnis der Öffentlichkeit nach Sicherheit und Gerechtigkeit. Andererseits steht der rechtsstaatliche Grundsatz, dass kranke Menschen, die für ihre Taten nicht verantwortlich sind, keine Strafe im klassischen Sinn erhalten, sondern Hilfe und Behandlung benötigen.
Die Einweisung in den Maßnahmenvollzug ist der Versuch, diesen beiden Anforderungen gerecht zu werden. Sie soll sicherstellen, dass gefährliche Personen von der Gesellschaft ferngehalten werden, solange sie eine Bedrohung darstellen. Gleichzeitig bietet sie die Chance auf eine medizinische Behandlung, die in einem normalen Gefängnis nicht in diesem Umfang möglich wäre.
Für die Opfer und ihre Angehörigen ist diese juristische Logik oft schwer zu akzeptieren. Das Gefühl, dass der Täter „nicht richtig bestraft“ wird, kann die Verarbeitung des Erlebten zusätzlich erschweren. Es verdeutlicht die komplexe Aufgabe des Rechtssystems, das sowohl die Rechte der Opfer als auch den Zustand der Täter berücksichtigen muss.