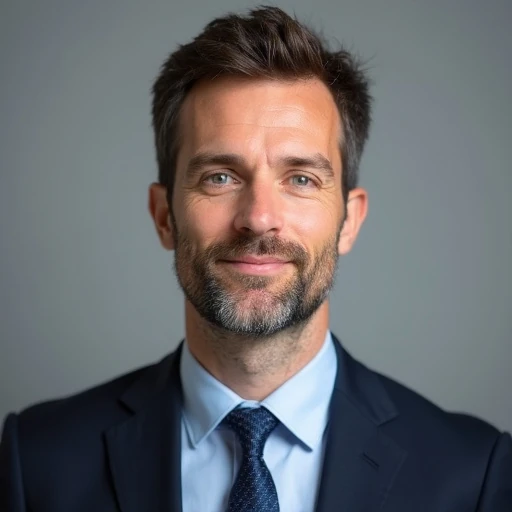Angesichts von Klimawandel, Fachkräftemangel und geopolitischen Spannungen steht der Tourismus im Alpenraum vor großen Herausforderungen. Bei einem Kongress an der Fachhochschule Salzburg wurden neue Strategien und digitale Werkzeuge vorgestellt, die Betrieben und ganzen Regionen helfen sollen, widerstandsfähiger zu werden und sich für die Zukunft zu rüsten.
Im Mittelpunkt der Veranstaltung „Resilienter Tourismus und Digitalisierung“ standen die Ergebnisse eines Forschungsprojekts, das konkrete Lösungen für die Branche entwickelt hat. Dazu gehören ein Index zur Messung der Krisenfestigkeit von Tourismusdestinationen und ein praktisches Tool für Unternehmen.
Wichtige Erkenntnisse
- Experten diskutierten an der FH Salzburg, wie der Tourismus widerstandsfähiger gegen Krisen werden kann.
- Ein neuer „Resilienz-Index“ macht die Krisenfestigkeit von Regionen erstmals messbar.
- Für Betriebe wurde ein digitales „Resilienz-Tool“ entwickelt, das eine Standortbestimmung und Handlungsempfehlungen bietet.
- Digitalisierung und verantwortungsvolle Unternehmensführung wurden als zentrale Faktoren für die Zukunftsfähigkeit identifiziert.
Die neue Normalität: Dauerhafte Krisen im Tourismus
Die Tourismusbranche sieht sich mit einer wachsenden Zahl an Belastungen konfrontiert. Der Klimawandel verändert die Bedingungen für den Winter- und Sommertourismus, während der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften viele Betriebe an ihre Grenzen bringt. Hinzu kommen wirtschaftliche Unsicherheiten und die Notwendigkeit, mit der rasanten Digitalisierung Schritt zu halten.
Diese komplexen Herausforderungen erfordern ein Umdenken. Anstatt auf einzelne Krisen nur zu reagieren, muss die Branche lernen, dauerhaft anpassungsfähig und widerstandsfähig zu sein. Genau hier setzte der Kongress an der FH Salzburg an, der als Plattform für den Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis diente.
INTERREG-Forschungsprojekt als Grundlage
Die vorgestellten Ergebnisse sind Teil des INTERREG-Forschungsprojekts „Resilienter Tourismus“. An diesem grenzüberschreitenden Projekt arbeiten die FH Salzburg, die FH Kufstein Tirol und der Chiemgau Tourismus e.V. aus Bayern gemeinsam. Das Ziel ist die Entwicklung von anwendbaren Lösungen, um den Tourismus im gesamten Alpenraum nachhaltig zu stärken.
Ein Maßstab für Stabilität: Der Resilienz-Index
Eine zentrale Frage für Destinationen lautet: Wie krisenfest sind wir wirklich? Um diese Frage objektiv beantworten zu können, entwickelte das Forschungsteam einen neuartigen Resilienz-Index. Dieses Instrument analysiert die Widerstandsfähigkeit einer Region anhand von drei Kernbereichen.
Die drei Säulen der Resilienz
- Ökonomie: Bewertet werden hier Faktoren wie die Abhängigkeit von einzelnen Saisons (Saisonalität) und die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Gäste. Eine breite wirtschaftliche Aufstellung erhöht die Stabilität.
- Ökologie: Dieser Bereich misst unter anderem den Anteil an nachhaltig zertifizierten Betrieben und die Tourismusdichte, um eine Überlastung natürlicher Ressourcen zu vermeiden.
- Gesellschaft: Hier fließen soziale Aspekte wie die Bezahlung der Mitarbeiter und die Tourismusintensität (Verhältnis von Touristen zu Einheimischen) in die Bewertung ein.
Erste Auswertungen zeigen, dass die Region Salzburg im oberen Mittelfeld liegt. Andere Gebiete wie der Chiemgau oder die Region Innsbruck weisen besonders hohe Resilienzwerte auf. „Resilienz ist komplex und schwer zu greifen“, erklärte Helena Gey von der FH Kufstein Tirol bei der Präsentation. „Darum ist Austausch so wichtig – Wissen muss geteilt, Innovationen gefördert werden.“
Praktische Hilfe für Unternehmen: Das Resilienz-Tool
Neben der Analyse ganzer Regionen wurde auch ein konkretes Werkzeug für einzelne Tourismusbetriebe entwickelt. Das digitale Resilienz-Tool soll Unternehmern dabei helfen, die eigene Position zu bewerten und sich gezielt auf zukünftige Herausforderungen vorzubereiten.
Das Tool kombiniert harte Finanzkennzahlen mit weichen Faktoren wie Mitarbeiterzufriedenheit oder Innovationskultur. Zusammen mit den Daten des regionalen Resilienz-Index ergibt sich so ein umfassendes Bild der Stärken und Schwächen eines Betriebs. Ein angebundener Maßnahmenkatalog liefert anschließend konkrete Vorschläge, etwa in den Bereichen strategische Planung, Mitarbeiterführung oder der Einführung neuer Technologien.
„Wir wollen Impulse setzen, die direkt in die Praxis wirken – in Betriebe, Regionen und in die Köpfe der Menschen.“
Damit wird wissenschaftliche Forschung direkt in anwendbare Unterstützung für die Wirtschaft umgewandelt. Unternehmen erhalten eine klare Anleitung, wie sie ihre Widerstandsfähigkeit systematisch verbessern können.
Anpassungsfähigkeit als Schlüssel zum Erfolg
Die Denkweise ändern
Der Genetiker und Autor Markus Hengstschläger betonte in seiner Eröffnungsrede die Bedeutung der geistigen Beweglichkeit. „Man muss sich auf die Dinge vorbereiten, auch ohne zu wissen, wann und woher Krisen kommen“, so der Wissenschaftler. Er rief dazu auf, proaktiv zu handeln, auch wenn der Weg noch unklar ist.
„Wer sich bewegt, erhöht seine Resilienz – und findet manchmal Lösungen, die er gar nicht gesucht hat.“
Diese Haltung prägte die Diskussionen des Tages: Es geht nicht darum, Krisen zu vermeiden, sondern darum, gestärkt aus ihnen hervorzugehen.
Verantwortung und Technologie
Alexander Aisenbrey, Geschäftsführer der Vorreiter AG und „Hotelier des Jahres“, sprach über die neue Rolle von Führungskräften. „Krisen sind keine Ausnahme mehr, sie sind die neue Normalität“, sagte er. „Wer bestehen will, muss Verantwortung übernehmen – für seine Mitarbeitenden, für die Umwelt und für sich selbst.“
Unterstützung kommt dabei zunehmend aus der Technologie. Experten wie Anja Kirig vom Zukunftsinstitut und Marco Maier von Tawny.AI zeigten, wie Künstliche Intelligenz (KI) den Tourismus effizienter und nachhaltiger gestalten kann. Beispiele sind die intelligente Steuerung des Ressourcenverbrauchs oder eine datengestützte, personalisierte Gästebetreuung. Die zentrale Botschaft war klar: „Digitalisierung und Resilienz gehören zusammen.“ Wer digitale Werkzeuge klug einsetzt, kann Krisen nicht nur bewältigen, sondern sie als Chance für Wachstum nutzen.