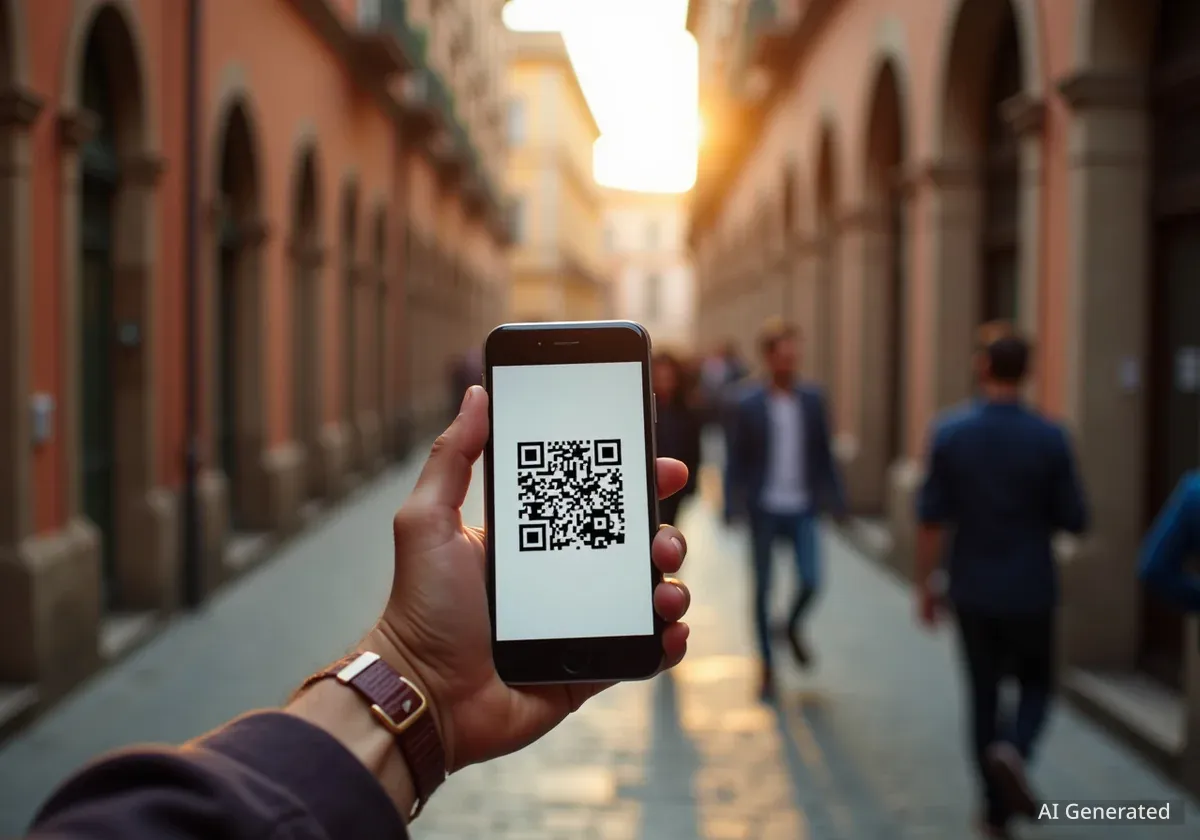Die NEOS-Fraktion im Salzburger Gemeinderat hat einen neuen Vorschlag zur Lenkung von Touristenströmen eingebracht. Mithilfe von QR-Codes sollen Besucher zu weniger bekannten Sehenswürdigkeiten abseits der überlaufenen Pfade geführt werden. Ziel der Initiative von Gemeinderat Lukas Rupsch ist es, die Hauptattraktionen zu entlasten und gleichzeitig das kulturelle Angebot der Stadt breiter zu präsentieren.
Das Wichtigste in Kürze
- Die NEOS Salzburg schlagen ein digitales Leitsystem mittels QR-Codes für Touristen vor.
- Die Initiative zielt darauf ab, Besucherströme von den bekannten Hotspots zu weniger frequentierten Orten zu lenken.
- Verborgene Sehenswürdigkeiten wie das Sisi-Denkmal am Hauptbahnhof oder Teile der alten Stadtmauer sollen dadurch sichtbarer werden.
- Der Antrag von Gemeinderat Lukas Rupsch soll eine nachhaltigere Form des Städtetourismus fördern.
Die Herausforderung des Massentourismus in Salzburg
Salzburg gehört zu den meistbesuchten Städten Europas. Jedes Jahr strömen Millionen von Touristen in die Altstadt, um die Geburtsstätte Mozarts, die Festung Hohensalzburg und die Getreidegasse zu erleben. Diese Konzentration auf wenige, weltberühmte Attraktionen führt jedoch zu erheblichen Belastungen.
Besonders in den Sommermonaten sind die engen Gassen der Altstadt oft überfüllt. Dies mindert nicht nur das Erlebnis für die Besucher, sondern stellt auch eine Belastung für die Anwohner und die städtische Infrastruktur dar. Die Suche nach effektiven Lösungen zur Besucherlenkung ist daher eine der zentralen Aufgaben der Stadtpolitik.
Salzburg in Zahlen
Vor der Pandemie verzeichnete die Stadt Salzburg jährlich über drei Millionen Ankünfte und mehr als sechs Millionen Nächtigungen. Ein Großteil dieser Besucher konzentriert sich auf die nur etwa einen Quadratkilometer große, zum UNESCO-Weltkulturerbe zählende Altstadt.
Ein digitaler Ansatz zur Besucherlenkung
Der von NEOS-Gemeinderat Lukas Rupsch eingebrachte Antrag setzt auf eine moderne, digitale Lösung. Die Idee ist, an strategischen Punkten in der Stadt QR-Codes zu installieren. Touristen können diese mit ihren Smartphones scannen und erhalten Informationen zu alternativen Routen und Sehenswürdigkeiten.
Wie das System funktionieren soll
Das Konzept sieht vor, dass die QR-Codes nicht nur trockene Fakten liefern, sondern interaktive Erlebnisse bieten. Sie könnten zu mobilen Webseiten führen, die:
- Geschichten erzählen: Anstatt nur Jahreszahlen aufzulisten, könnten kurze Videos oder Audio-Guides die Geschichte eines Ortes lebendig machen.
- Alternative Routen vorschlagen: Je nach Standort könnte die Anwendung dem Nutzer einen Spaziergang zu einem nahegelegenen, aber weniger bekannten Ort vorschlagen.
- Gamification-Elemente enthalten: Eine Art digitale Schnitzeljagd könnte Besucher dazu anregen, gezielt nach verborgenen Orten zu suchen und dabei die Stadt neu zu entdecken.
Diese digitale Infrastruktur wäre laut Antrag eine kostengünstige und flexible Methode, um auf Besucherströme zu reagieren und das touristische Angebot zu diversifizieren.
Verborgene Schätze Salzburgs ins Licht rücken
Salzburg hat weit mehr zu bieten als die allgemein bekannten Hotspots. Der NEOS-Antrag nennt konkrete Beispiele für Orte, die durch das QR-Code-System eine neue Wertschätzung erfahren könnten.
Das vergessene Sisi-Denkmal
Ein prominentes Beispiel ist das Denkmal für Kaiserin Elisabeth, bekannt als Sisi, das sich in der Nähe des Hauptbahnhofs befindet. Viele Besucher und auch Einheimische gehen achtlos daran vorbei. Oft wird der Ort zweckentfremdet, anstatt als historisches Monument gewürdigt zu werden.
„Ein QR-Code könnte hier die faszinierende Geschichte von Sisis Besuchen in Salzburg erzählen und das Denkmal aus seinem Schattendasein holen“, so die Argumentation hinter dem Vorschlag.
Durch eine digitale Aufbereitung könnte die Bedeutung des Denkmals vermittelt und seine historische Relevanz wiederhergestellt werden. Dies würde nicht nur den Ort selbst aufwerten, sondern auch den Bereich um den Hauptbahnhof für ankommende Gäste attraktiver machen.
Die wiederentdeckte Stadtmauer
Ein weiteres Beispiel sind die erst vor einigen Jahren wieder freigelegten Teile der historischen Stadtbefestigung. Diese Überreste der alten Stadtmauer sind für viele unsichtbar, obwohl sie ein wichtiges Zeugnis der Salzburger Geschichte darstellen.
Historische Befestigungsanlagen
Salzburg verfügte über mehrere Ringe von Befestigungsanlagen, die über Jahrhunderte ausgebaut wurden. Viele Teile wurden im 19. Jahrhundert geschleift, um Platz für die wachsende Stadt zu schaffen. Die wiederentdeckten Abschnitte bieten einen seltenen Einblick in die militärische Vergangenheit der Stadt.
Ein QR-Code an diesen Stellen könnte mittels Augmented Reality (AR) die ursprüngliche Mauer virtuell wieder auferstehen lassen und ihre Funktion im historischen Stadtbild erklären.
Mehr als nur Mozart: Die verborgenen Geschichten
Der Vorschlag zielt auch darauf ab, die Geschichten von Persönlichkeiten zu erzählen, die mit Salzburg verbunden sind, aber oft im Schatten der großen Namen stehen. Der ursprüngliche Bericht der Salzburger Nachrichten verweist auf die Geschichte von Mileva Marić, der ersten Ehefrau Albert Einsteins.
Obwohl sie keinen direkten Bezug zu Salzburg hatte, dient ihr Beispiel als Metapher: Es gibt viele wichtige Figuren, insbesondere Frauen in der Wissenschaft und Kunst, deren Beiträge oft übersehen werden. Ein QR-Code-System könnte genutzt werden, um an relevanten Orten auf solche vergessenen Biografien aufmerksam zu machen und so ein vielschichtigeres Bild der Stadtgeschichte zu zeichnen.
Potenzial und nächste Schritte
Die Implementierung eines solchen Systems würde eine enge Zusammenarbeit zwischen der Stadtverwaltung, Salzburg Tourismus und Historikern erfordern. Die Inhalte müssten sorgfältig kuratiert und in mehreren Sprachen verfügbar gemacht werden, um eine breite Zielgruppe zu erreichen.
Der Antrag der NEOS wird nun in den zuständigen Ausschüssen des Gemeinderats behandelt. Dort wird geprüft, ob die Idee technisch umsetzbar und finanzierbar ist. Sollte der Vorschlag angenommen werden, könnte Salzburg ein innovatives Modell für nachhaltigen Städtetourismus schaffen, das auch für andere historische Städte als Vorbild dienen könnte. Es wäre ein Schritt weg vom reinen „Abhaken“ von Sehenswürdigkeiten hin zu einem tieferen, persönlicheren Erleben der Stadt.