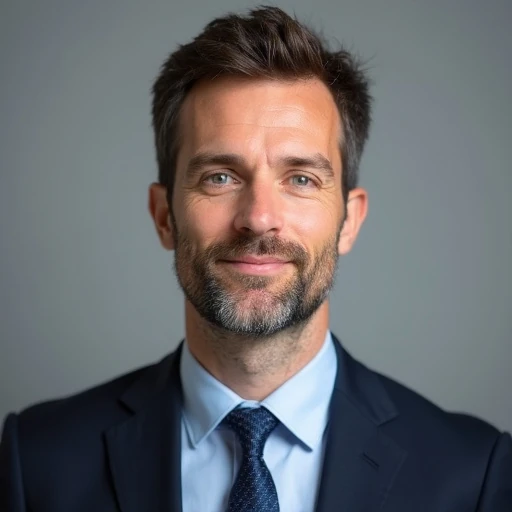Die Wintersaison im Salzburger Land zeigt ein Bild der Extreme. Während große Seilbahnunternehmen Rekordumsätze und Millionengewinne verzeichnen, kämpfen viele kleinere Liftbetreiber ums wirtschaftliche Überleben. Die Schere zwischen den Giganten der Branche und den lokalen Anbietern geht immer weiter auf.
Besonders die großen Skiverbünde profitieren von der hohen Nachfrage und modernen Infrastruktur. Demgegenüber stehen kleinere Skigebiete, die mit steigenden Kosten und dem Klimawandel zu kämpfen haben und eine wichtige Rolle für die lokale Bevölkerung spielen.
Das Wichtigste in Kürze
- Große Skigebiete wie der Skicircus Saalbach erzielen Umsätze von über 120 Millionen Euro pro Saison.
- Kleinere Liftbetreiber kämpfen mit hohen Energiekosten und Investitionsdruck.
- Der Klimawandel und die Notwendigkeit technischer Beschneiung verschärfen die finanzielle Lage.
- Die kleinen Lifte sind oft entscheidend für den lokalen Nachwuchs und den Breitensport.
Die Giganten des Wintersports
An der Spitze der Branche stehen die großen, international bekannten Skigebiete, die als wahre Wirtschaftsmotoren für ihre Regionen fungieren. Ein herausragendes Beispiel ist der Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn. Mit einem Umsatz von 122 Millionen Euro in der Wintersaison 2024/2025 konnte das Unternehmen seinen Vorjahresumsatz um drei Prozent steigern.
Solche Zahlen sind das Ergebnis strategischer Investitionen über viele Jahre. Moderne Seilbahnen, weitläufige Pistennetze und leistungsfähige Beschneiungsanlagen sichern den Betrieb auch in schneearmen Wintern. Diese Skigebiete ziehen ein internationales Publikum an und sind nicht nur im Winter, sondern zunehmend auch im Sommer wichtige Tourismusdestinationen.
Zahlenspiele im Schnee
Der Umsatz von 122 Millionen Euro im Skicircus Saalbach entspricht dem Verkauf von rund 2,5 Millionen Tageskarten für Erwachsene in der Hauptsaison. Diese Zahl verdeutlicht die enorme Frequenz und Wirtschaftskraft, die in den großen Skizentren gebündelt wird.
Was den Erfolg ausmacht
Der Erfolg der großen Player basiert auf mehreren Säulen. Zum einen ermöglichen Skiverbünde den Zusammenschluss mehrerer Gebiete, was den Gästen ein riesiges Angebot an Pisten und Abwechslung bietet. Zum anderen erlauben es die hohen Umsätze, kontinuierlich in die Qualität und den Komfort zu investieren.
Dazu gehören nicht nur neue Lifte, sondern auch digitale Services wie Apps zur Navigation im Skigebiet, Online-Ticketing und dynamische Preissysteme. Diese Professionalisierung schafft ein Premium-Erlebnis, für das viele Kunden bereit sind, entsprechend zu bezahlen.
Wirtschaftsfaktor Tourismus
Die Seilbahnwirtschaft ist eine tragende Säule des Salzburger Tourismus. Die großen Unternehmen sind bedeutende Arbeitgeber, die hunderte von saisonalen und ganzjährigen Arbeitsplätzen schaffen. Sie sichern zudem die Auslastung von Hotels, Gastronomie und lokalen Dienstleistern und tragen maßgeblich zur Wertschöpfung in den ländlichen Tälern bei.
Der Überlebenskampf der kleinen Lifte
Während in den großen Skiarenen die Kassen klingeln, sieht die Realität in vielen kleineren Skigebieten des Landes deutlich anders aus. Oft handelt es sich um einzelne Dorflifte oder kleine, von Gemeinden betriebene Anlagen, die für das lokale Leben von unschätzbarem Wert sind, wirtschaftlich aber unter enormem Druck stehen.
Die Gründe dafür sind vielfältig. An erster Stelle stehen die explodierenden Energiekosten. Der Betrieb von Schleppliften und vor allem von Schneekanonen ist extrem energieintensiv. Für kleine Betreiber mit begrenzten Budgets wird die Stromrechnung schnell zur existenziellen Bedrohung.
„Für uns geht es nicht um Gewinnmaximierung, sondern darum, den Kindern im Dorf das Skifahren beizubringen. Aber wenn die Kosten für eine Betriebsstunde die Einnahmen eines ganzen Tages übersteigen, wird es schwierig“, erklärt der Betriebsleiter eines kleinen Skilifts im Pongau, der anonym bleiben möchte.
Investitionsstau und Klimawandel
Ein weiteres Problem ist der hohe Investitionsbedarf. Viele kleine Lifte sind in die Jahre gekommen und müssten modernisiert werden. Gleichzeitig zwingt der Klimawandel zu teuren Investitionen in die technische Beschneiung, um überhaupt eine Saison garantieren zu können. Diese Summen sind für kleine Betreiber oft nicht aufzubringen.
Die Folgen sind spürbar:
- Verkürzte Betriebszeiten: Einige Lifte öffnen nur noch an den Wochenenden oder in den Ferien.
- Eingeschränktes Angebot: Auf die Beschneiung von weniger frequentierten Pisten wird oft verzichtet.
- Komplette Schließungen: In den letzten Jahren mussten immer wieder kleine Skigebiete ihren Betrieb endgültig einstellen.
Eine Branche im Wandel
Die unterschiedlichen Entwicklungen werfen die Frage nach der Zukunft des Wintersports im Salzburger Land auf. Experten sehen eine zunehmende Konzentration auf wenige, hochprofitable Skizentren. Diese Entwicklung hat weitreichende Konsequenzen.
Einerseits sichern die großen Skigebiete die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Tourismusregion Salzburg. Sie sind unverzichtbar für die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt. Andererseits geht mit dem Verschwinden der kleinen Lifte ein wichtiger Teil der lokalen Kultur und Lebensqualität verloren.
Die soziale Bedeutung der Dorflifte
Die kleinen Anlagen sind oft der erste Ort, an dem Kinder das Skifahren lernen. Sie bieten leistbare Skipässe für Familien und sind wichtige soziale Treffpunkte für die lokale Gemeinschaft. Skiclubs nutzen sie für das Training ihres Nachwuchses. Fällt diese Infrastruktur weg, wird der Zugang zum Skisport für viele Einheimische teurer und komplizierter.
Es entsteht eine Zweiklassengesellschaft im Wintersport: auf der einen Seite der hochpreisige Event-Tourismus in den großen Arenen, auf der anderen Seite der Breitensport, dem die Basis entzogen wird. Die Politik und die Tourismusverbände sind gefordert, Lösungen zu finden, um auch die Zukunft der kleinen, aber wichtigen Liftbetriebe zu sichern.