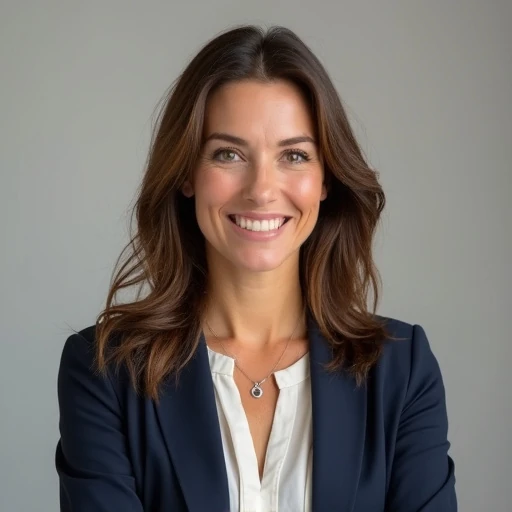Im Großraum Salzburg, insbesondere in den Bezirken Flachgau und Tennengau, herrscht ein gravierender Mangel an offiziell freigegebenen Mountainbike-Strecken. Der Verein Mountainbike Salzburg kritisiert die aktuelle Situation scharf und verweist auf die komplexen rechtlichen Hürden, die eine Legalisierung von Wegen erschweren. Während in den ländlichen Gebirgsgauen das Angebot wächst, stehen Biker im städtischen Umland vor verschlossenen Wegen.
Das Wichtigste in Kürze
- Im Salzburger Zentralraum gibt es trotz 12.000 Kilometern Forstwegen kaum legale Mountainbike-Routen.
- Die Zustimmung vieler verschiedener Grundeigentümer für eine einzige Strecke ist die größte Hürde.
- Eine neue Koordinationsstelle des Bundes soll helfen, doch es herrscht Skepsis.
- In den Gebirgsgauen ist die Situation durch Tourismusverbände und einfachere Besitzverhältnisse deutlich besser.
- Österreichs restriktive Gesetze für Forststraßen sind im europäischen Vergleich eine Ausnahme.
Ein Netz aus Wegen, das nicht genutzt werden darf
Das Bundesland Salzburg verfügt über ein beeindruckendes Netz von rund 12.000 Kilometern an Forst- und Almwegen. Doch für Mountainbiker ist dieses Potenzial kaum zugänglich, besonders in der Nähe der Landeshauptstadt. Andreas Hörlesberger vom Verein Mountainbike Salzburg (MTB) beschreibt die Lage als „eklatant“. Der Verein, der in Zusammenarbeit mit dem ASKÖ den einzigen offiziellen Trail in Stadtnähe am Heuberg betreut, kämpft seit Jahren für mehr legale Möglichkeiten.
Besonders frustrierend sei die Situation am Gaisberg, einem beliebten Naherholungsgebiet. Trotz jahrelanger Verhandlungen scheitert die Einrichtung einer legalen Strecke am Widerstand eines einzigen Grundeigentümers. Dieses Beispiel verdeutlicht das Kernproblem im Zentralraum.
Das Problem der zersplitterten Eigentumsverhältnisse
Laut Hörlesberger liegt die Hauptschwierigkeit in den kleinteiligen Besitzstrukturen. „Für eine einzige Forststraße sind oft zehn verschiedene Grundeigentümer zuständig“, erklärt er. „Wenn nur einer von ihnen seine Zustimmung verweigert, kann der gesamte Weg nicht legalisiert werden.“ Diese Regelung führt dazu, dass selbst breite und gut ausgebaute Wege, die von Fahrzeugen befahren werden können, für Radfahrer tabu bleiben.
Salzburgs Wegenetz in Zahlen
Das Bundesland Salzburg hat insgesamt etwa 12.000 Kilometer an Forst- und Almwegen. Ein Großteil davon ist für das Mountainbiken gesetzlich gesperrt, was zu ständigen Konflikten und Unsicherheiten für Sportler führt.
Neue Bundesstelle weckt verhaltene Hoffnung
Ende August wurde eine Mountainbike-Koordinationsstelle des Bundes eingerichtet, die als Vermittler auftreten und die Schaffung legaler Trails unterstützen soll. Andreas Hörlesberger und sein Verein setzen Hoffnungen in diese neue Einrichtung, bleiben aber skeptisch, ob vertragliche Lösungen allein zum Ziel führen.
„Vertragliche und versicherungstechnische Lösungen klingen immer sehr gut, und wir sind auch dafür. Aber wenn man sich Beispiele wie Salzburg und Innsbruck ansieht, erkennt man, dass es trotz perfekter Vorlagen im städtischen Raum so gut wie kein Angebot gibt.“
Die Erfahrung zeigt, dass selbst mit ausgearbeiteten Verträgen und Versicherungsschutz die Zustimmung der Eigentümer oft nicht zu erlangen ist. Dies stellt die Wirksamkeit des neuen Ansatzes infrage, zumindest in den dicht besiedelten Gebieten.
Ländlicher Raum als Vorbild
Ganz anders stellt sich die Situation in den Gebirgsgauen wie dem Pinzgau oder Pongau dar. Dort ist das Angebot an Mountainbike-Strecken in den letzten Jahren stetig gewachsen. Hörlesberger sieht dafür mehrere Gründe:
- Tourismus als Motor: Bergbahnen und Tourismusverbände haben das wirtschaftliche Potenzial des Mountainbikens erkannt und investieren aktiv in die Infrastruktur.
- Einfachere Besitzverhältnisse: Oft gehören große Waldflächen wenigen Eigentümern, wie den Bundesforsten, was Verhandlungen erheblich vereinfacht.
- Größere Offenheit: Grundeigentümer im ländlichen Raum sind laut Hörlesberger oft offener für Pachtverträge und die damit verbundenen Einnahmen. „Im städtischen Bereich gibt es doch immer wieder Grundeigentümer, die auf 1.000 bis 2.000 Euro im Jahr nicht angewiesen sind“, fügt er hinzu.
Diese Entwicklung führt zu dem Paradox, dass Mountainbiker aus dem Zentralraum oft weite Anfahrtswege mit dem Auto in Kauf nehmen müssen, um ihren Sport legal ausüben zu können.
Sport vor der Haustür bleibt ein Wunsch
Hörlesberger betont die Bedeutung eines stadtnahen Angebots. „Eine der Schönheiten dieses Sports ist ja, dass man direkt von der Haustür aus starten kann, ohne Auto und ohne Eintrittsgebühren.“ Diese niederschwellige Zugänglichkeit ist rund um Salzburg jedoch kaum gegeben. Stattdessen fahren Biker mit der ständigen Sorge, auf einem verbotenen Weg fotografiert oder angezeigt zu werden.
Österreich im internationalen Vergleich
Österreichs strenge Regelung, die das Befahren von Forststraßen grundsätzlich verbietet, ist in Europa eine Seltenheit. In den meisten Nachbarländern ist die Rechtslage deutlich liberaler:
- Bayern: Wege, die zu Fuß begangen werden dürfen, sind in der Regel auch für Fahrräder freigegeben.
- Italien & Slowenien: Das Befahren von Forststraßen ist weitgehend erlaubt.
- Schweiz & Frankreich: Ähnlich liberale Regelungen ermöglichen ein unkompliziertes Nebeneinander von Wanderern und Bikern.
Diese Vergleiche zeigen, dass Österreich laut Interessenvertretern „allein auf weiter Flur“ steht und alternative Modelle erfolgreich praktiziert werden.
Ein Appell für ein Umdenken
Die Diskussion um legale Mountainbike-Wege im Salzburger Zentralraum ist mehr als ein Nischenthema für Sportler. Es geht um die Nutzung von Naherholungsräumen, die Förderung von Gesundheit und umweltfreundlicher Freizeitgestaltung. Der Verein Mountainbike Salzburg fordert ein Umdenken bei Politik und Grundeigentümern, um eine Lösung zu finden, die allen Beteiligten gerecht wird.
Die Hoffnung liegt nun auf der neuen Bundes-Koordinationsstelle, die möglicherweise den nötigen Druck erzeugen kann, um festgefahrene Strukturen aufzubrechen und Salzburgs Umland für Mountainbiker endlich legal zugänglich zu machen.