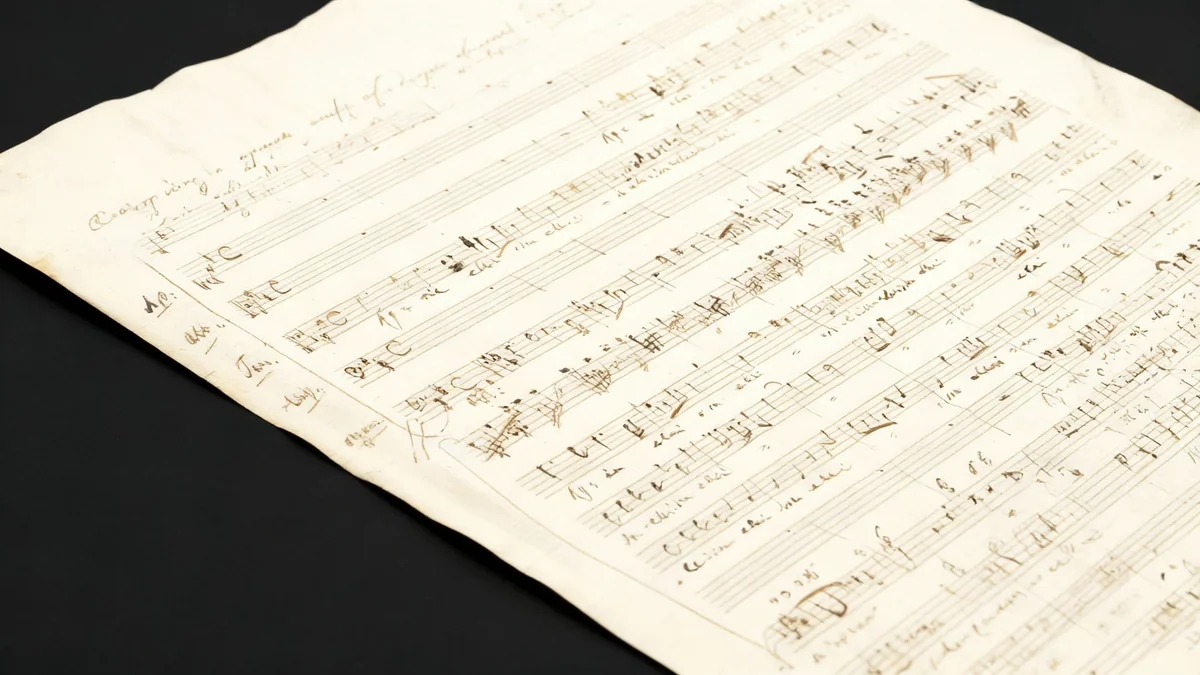Ein Kunstwerk mit einer dramatischen Geschichte hat in Salzburg sein versöhnliches Ende gefunden. Das 1941 vom polnisch-jüdischen Maler Jecheskiel David Kirszenbaum in einem französischen Internierungslager geschaffene Ölgemälde „Die Internierten von Saint Sauveur“ wurde am Donnerstag offiziell an die rechtmäßigen Erben zurückgegeben.
Das Werk galt jahrzehntelang als verschollen, nachdem es in den 1990er-Jahren in Bukarest gestohlen wurde. Die feierliche Übergabe in Salzburg schließt ein langes Kapitel der Suche und Ungewissheit ab und rückt das Schicksal eines von den Nationalsozialisten verfolgten Künstlers erneut ins Bewusstsein.
Das Wichtigste in Kürze
- Restitution in Salzburg: Das Gemälde „Die Internierten von Saint Sauveur“ wurde an die Erben des Künstlers zurückgegeben.
- Historischer Ursprung: Jecheskiel David Kirszenbaum malte es 1941 während seiner Internierung in einem Lager in Südwestfrankreich.
- Jahrzehntelang verschollen: Das Kunstwerk wurde in den 1990er-Jahren in Bukarest gestohlen und tauchte erst kürzlich wieder auf.
- Symbolische Bedeutung: Die Rückgabe ist ein wichtiger Akt der historischen Gerechtigkeit und Erinnerung an NS-Opfer.
Ein Zeugnis aus dunkler Zeit
Das Ölgemälde „Die Internierten von Saint Sauveur“ ist mehr als nur ein Kunstwerk; es ist ein historisches Dokument. Jecheskiel David Kirszenbaum (1900–1954) schuf es unter widrigsten Umständen. Nach der Besetzung Frankreichs durch die Nationalsozialisten wurde der aus Polen stammende jüdische Künstler verhaftet und in einem Lager in Saint Sauveur in den Pyrenäen interniert.
Inmitten von Leid und Ungewissheit hielt Kirszenbaum an seiner Kunst fest. Das Gemälde zeigt eine düstere, eindringliche Szene aus dem Lageralltag. Es fängt die bedrückende Atmosphäre und die Hoffnungslosigkeit der Inhaftierten ein und dient als kraftvolles Zeugnis des menschlichen Geistes, der selbst unter extremer Not kreativ bleibt.
Der Künstler Jecheskiel David Kirszenbaum
Kirszenbaum war Teil der berühmten „École de Paris“ und studierte in den 1920er-Jahren am Bauhaus in Weimar unter Meistern wie Paul Klee und Wassily Kandinsky. Seine Werke waren von der jüdischen Kultur und den avantgardistischen Strömungen seiner Zeit geprägt. Die Verfolgung durch die Nationalsozialisten zwang ihn zur Flucht, doch er wurde gefasst und interniert. Viele seiner Werke wurden während des Krieges zerstört.
Eine Odyssee durch Europa
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gelang es Kirszenbaum, das Gemälde zu retten. Es wurde Teil seines Nachlasses und begleitete seine Familie über Jahrzehnte. Doch die Geschichte des Bildes war noch nicht zu Ende. In den turbulenten Jahren nach dem Fall des Eisernen Vorhangs wurde das Werk in den 1990er-Jahren aus einer Sammlung in Bukarest, Rumänien, gestohlen.
Danach verlor sich seine Spur. Für die Erben des Künstlers begann eine lange und oft frustrierende Suche. Das Gemälde schien für immer im Dunkel des internationalen Kunstmarktes verschwunden zu sein. Solche Fälle sind komplex, da gestohlene Kunstwerke oft über verschlungene Wege den Besitzer wechseln, um ihre Herkunft zu verschleiern.
Die überraschende Wiederentdeckung
Die Wende kam erst nach vielen Jahren, als das Gemälde unerwartet wieder auftauchte. Durch die sorgfältige Arbeit von Kunsthistorikern, Provenienzforschern und internationalen Ermittlungsbehörden konnte die Identität und die unrechtmäßige Herkunft des Werkes zweifelsfrei festgestellt werden. Die genauen Umstände seiner Wiederentdeckung bleiben Teil einer diskreten Untersuchung, die schließlich zur Sicherstellung des Bildes führte.
Der Prozess der Restitution, also der Rückgabe an die rechtmäßigen Eigentümer, ist oft langwierig und erfordert den Nachweis einer lückenlosen Eigentümerkette. Im Fall von „Die Internierten von Saint Sauveur“ gelang es den Erben, ihre Ansprüche zweifelsfrei zu belegen.
Die Bedeutung der Provenienzforschung
Die Provenienzforschung spielt eine entscheidende Rolle bei der Aufklärung von Kunstdiebstählen und der Rückgabe von Raubkunst. Experten verfolgen die Besitzgeschichte eines Kunstwerks zurück, um Lücken oder unrechtmäßige Besitzerwechsel aufzudecken. Internationale Datenbanken für gestohlene Kunst sind dabei ein wichtiges Werkzeug.
Ein Moment der Gerechtigkeit in Salzburg
Dass die feierliche Übergabe nun in Salzburg stattfand, ist ein bedeutendes Signal. Die Stadt, die selbst eine komplexe Geschichte im Zusammenhang mit der NS-Zeit hat, wird so zum Schauplatz eines Aktes der Wiedergutmachung. Die Rückgabe ist nicht nur ein juristischer Erfolg, sondern auch ein zutiefst emotionaler Moment für die Nachkommen des Künstlers.
Es ist ein später Sieg der Gerechtigkeit über das Unrecht, das Künstlern wie Kirszenbaum angetan wurde. Ihre Kunst wurde nicht nur als „entartet“ diffamiert, sondern auch systematisch geraubt oder zerstört. Jedes zurückgegebene Werk stellt ein Stück weit die kulturelle Identität und das Erbe wieder her, das die Nationalsozialisten auslöschen wollten.
Die Rückgabe solcher Werke ist ein wesentlicher Beitrag zur Aufarbeitung der Geschichte und eine Anerkennung des Leids der Opfer des Nationalsozialismus.
Was mit dem Gemälde nach der Rückgabe geschehen wird, ist noch offen. Oft entscheiden sich Erben dafür, solche Werke an Museen zu stiften oder sie öffentlich auszustellen, um die Geschichte dahinter mit einem breiten Publikum zu teilen. Unabhängig von der Zukunft des Bildes ist seine Rückkehr ein starkes Symbol der Hoffnung und der unermüdlichen Bemühungen, historisches Unrecht zu korrigieren.