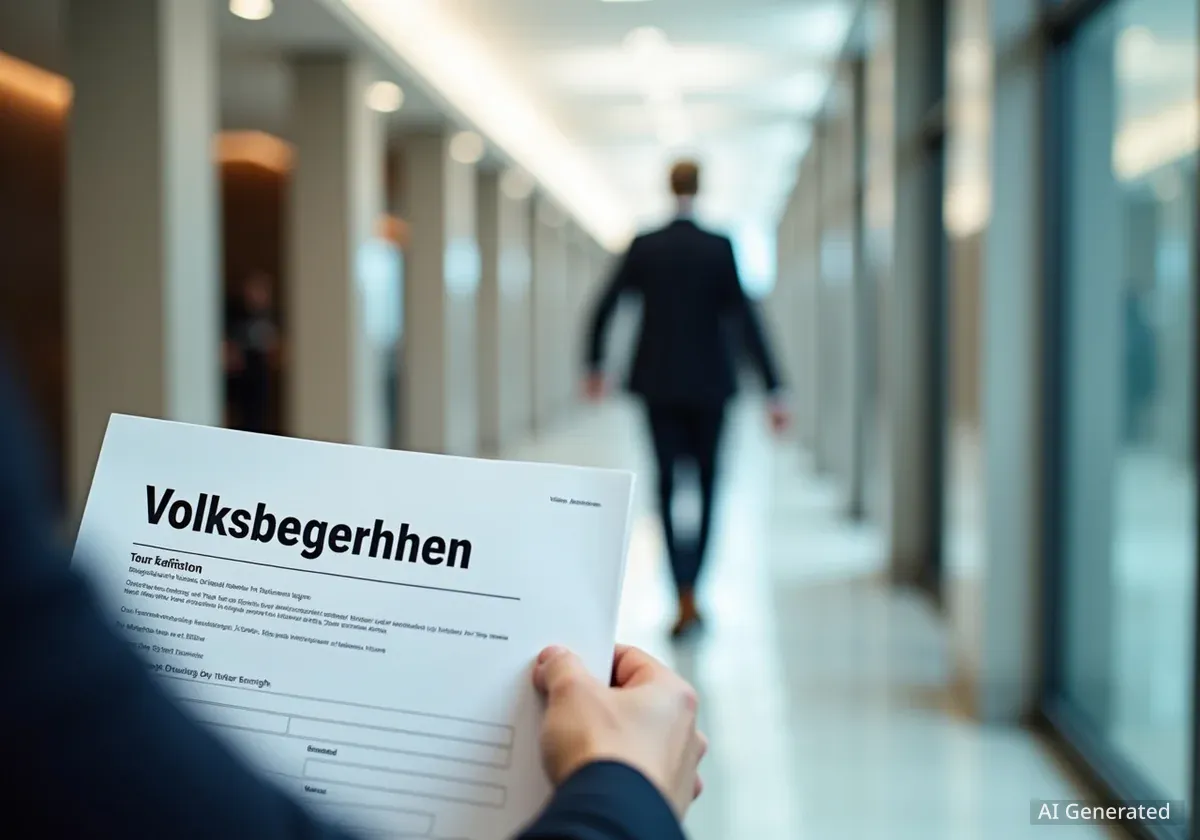Eine Mutter aus Seekirchen im Flachgau hat ein Volksbegehren ins Leben gerufen, das eine grundlegende Reform der Elternkarenz in Österreich fordert. Die Initiative zielt darauf ab, die finanzielle Sicherheit für Familien zu verbessern, die Karenzzeit zu verlängern und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu erleichtern.
Wichtige Punkte
- Eine Initiative aus Salzburg fordert eine Verlängerung der Karenzzeit auf 36 Monate.
- Mindestens 18 Monate sollen mit 80 Prozent des letzten Nettoeinkommens vergütet werden.
- Die Initiatorin kritisiert die unflexiblen aktuellen Modelle und den Mangel an Kinderbetreuungsplätzen.
- Das Volksbegehren benötigt 100.000 Unterschriften, um im Nationalrat behandelt zu werden.
Unzufriedenheit mit bestehenden Karenzmodellen
Elisa Fleiss, eine 31-jährige Informatikerin und Mutter aus Seekirchen, ist die treibende Kraft hinter dem „Karenzbegehren“. Sie argumentiert, dass die derzeitigen Regelungen zur Elternkarenz in Österreich nicht mehr den Bedürfnissen moderner Familien entsprechen. „Die bestehenden Karenzmodelle schaffen schlechte Bedingungen für Eltern und machen es schwer, Beruf und Familie miteinander zu vereinbaren“, erklärte Fleiss.
Ihrer Ansicht nach führt das aktuelle System insbesondere für Frauen zu erheblichen finanziellen und zeitlichen Nachteilen. Viele Eltern, so die Initiatorin, stehen vor der Herausforderung, nach nur einem Jahr Karenz wieder in den Beruf einsteigen zu müssen, ohne eine adäquate Betreuungsmöglichkeit für ihr Kind zu haben.
Die Kernforderungen des Volksbegehrens
Das von Fleiss initiierte Volksbegehren stellt mehrere konkrete Forderungen zur Neugestaltung der Elternkarenz. Ziel ist es, ein flexibleres und finanziell abgesichertes System zu schaffen. Die Vorschläge im Detail:
- Verlängerung der Karenzzeit: Die Gesamtdauer der Karenz soll auf 36 Monate ausgedehnt werden. Diese Zeit soll flexibel zwischen Mutter und Vater aufteilbar sein.
- Höhere Vergütung: Für mindestens 18 Monate der Karenzzeit wird eine Vergütung in Höhe von 80 Prozent des letzten Nettoeinkommens gefordert.
- Gesicherter Arbeitsplatz: Der Anspruch auf den bisherigen Arbeitsplatz nach der Karenz soll klar geregelt und garantiert sein.
- Erweiterter Kündigungsschutz: Der Kündigungsschutz für Eltern soll bis zu einem Jahr nach dem Ende der Karenzzeit gelten, um den Wiedereinstieg zu erleichtern.
- Gleichstellung für Selbstständige: Auch Selbstständige sollen Anspruch auf Karenz- und Betreuungsgelder in gleicher Höhe und Dauer wie Angestellte haben.
Hintergrund: Aktuelle Karenzregelungen in Österreich
Derzeit können Eltern in Österreich maximal 24 Monate nach der Geburt eines Kindes in Karenz gehen. Es gibt zwei Hauptmodelle: das einkommensabhängige und das pauschale Kinderbetreuungsgeld. Das einkommensabhängige Modell bietet bis zu 80 % des letzten Nettoeinkommens (gedeckelt bei 69,83 Euro pro Tag, Stand 2025) für maximal 14 Monate, wenn beide Elternteile die Karenz nutzen. Das pauschale Modell bietet je nach gewählter Dauer einen festen Tagesbetrag, der sich auf bis zu zwei Jahre und elf Monate verteilen lässt.
Herausforderung Kinderbetreuung und Väterbeteiligung
Ein zentrales Problem, das Elisa Fleiss anspricht, ist der Mangel an Betreuungsplätzen für Kleinkinder unter drei Jahren. „Viele Eltern in Salzburg wissen, wie schwierig es ist, Beruf und Familie zu vereinbaren“, so Fleiss. Besonders im ländlichen Raum sei es oft unmöglich, nach nur einem Jahr einen Betreuungsplatz zu finden. Diese Erfahrung habe sie nicht nur selbst gemacht, sondern auch im Gespräch mit anderen Familien in ihrem Umfeld bestätigt bekommen.
Diese Lücke im Betreuungssystem zwingt viele Mütter, länger als geplant zu Hause zu bleiben, oft ohne finanzielle Absicherung. Dies führt zu beruflichen Nachteilen und verstärkt die finanzielle Abhängigkeit.
Geringe Väterbeteiligung in Österreich
Laut Daten des Momentum Instituts nehmen nur rund 16 Prozent der Väter in Österreich mindestens einen Tag Elternkarenz in Anspruch. Mit diesem Wert zählt Österreich zu den Schlusslichtern innerhalb der Europäischen Union, was die Beteiligung von Vätern an der Kinderbetreuung betrifft.
Langfristige finanzielle Folgen für Frauen
Die Initiatorin des Volksbegehrens weist auf die langfristigen Konsequenzen der aktuellen Regelungen hin. Längere Erwerbsunterbrechungen und die häufig darauffolgende Teilzeitarbeit wirken sich direkt auf die Pensionsansprüche von Frauen aus. Dies erhöht das Risiko der Altersarmut erheblich.
„Man muss sich schon fragen, warum so viele gezwungen sind, dafür Umwege zu gehen“, sagt Fleiss.
Sie verweist auf die früher oft genutzte Bildungskarenz, die für viele Mütter eine Möglichkeit war, die Betreuungszeit für ihre Kinder zu verlängern und sich gleichzeitig weiterzubilden. Faire und flexible Modelle seien dringend notwendig, um Familien wirklich abzusichern und finanzielle Nachteile auszugleichen.
Gesellschaftliche Neubewertung von Familien gefordert
Neben den rechtlichen und finanziellen Aspekten fordert Elisa Fleiss auch ein Umdenken in der Gesellschaft. Sie kritisiert, dass Familien und Kinder oft als Belastung wahrgenommen werden, anstatt als wesentlicher Teil des sozialen Fundaments.
„Die Prioritäten sind gesellschaftlich falsch gesetzt. Familien und Kinder werden oft als Last gesehen, dabei sind sie das Fundament unserer Gesellschaft“, betont sie. Eine Reform der Karenz sei daher auch ein Signal für eine höhere Wertschätzung von Familienarbeit.
Die Reaktionen auf ihre Initiative seien gemischt, berichtet Fleiss. Während viele Eltern und Unterstützer das Engagement begrüßen, äußern andere Skepsis gegenüber der Wirksamkeit von Volksbegehren. Fleiss bleibt jedoch optimistisch und verweist auf historische Erfolge: „Auch die 40-Stunden-Woche konnte über ein Volksbegehren durchgesetzt werden.“
Der Weg des Volksbegehrens
Damit das „Karenzbegehren“ erfolgreich ist, muss es mehrere Hürden nehmen. Der Prozess ist klar geregelt:
- Unterstützungserklärungen: Zunächst müssen rund 9.000 Unterstützungserklärungen gesammelt werden, damit das Volksbegehren offiziell eingeleitet wird.
- Unterschriftenphase: Nach der offiziellen Einleitung müssen mindestens 100.000 in Österreich wahlberechtigte Personen das Begehren unterschreiben.
- Behandlung im Nationalrat: Wird die Hürde von 100.000 Unterschriften erreicht, muss sich der Nationalrat mit den Forderungen des Volksbegehrens befassen.
Unterschriften für das Volksbegehren können online über die entsprechende Plattform des Bundes oder persönlich in jedem Gemeindeamt in Österreich geleistet werden.