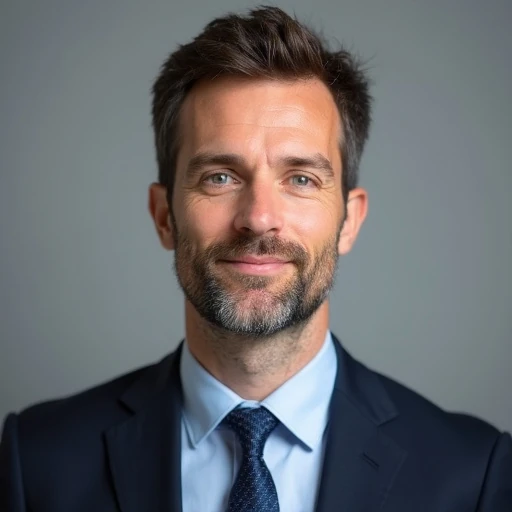Am Samstag, dem 4. Oktober 2025, fand in ganz Österreich der jährliche Zivilschutz-Probealarm statt. Im Bundesland Salzburg wurden 521 Sirenenanlagen auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft. Wie der Landesfeuerwehrverband mitteilte, blieben dabei zwei Sirenen stumm, was einer Erfolgsquote von 99,62 Prozent entspricht. Dieser Test dient der Überprüfung der technischen Infrastruktur und der Sensibilisierung der Bevölkerung für die Warnsignale.
Das Wichtigste in Kürze
- Beim jährlichen Zivilschutz-Probealarm am 4. Oktober 2025 wurden in Salzburg 521 Sirenen getestet.
- Zwei Anlagen im Bundesland fielen aus, was eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr mit vier Ausfällen darstellt.
- Österreichweit funktionierten 99,56 Prozent der über 8.300 Sirenen einwandfrei.
- Parallel zum akustischen Alarm wurde das digitale Warnsystem AT-Alert über Mobiltelefone getestet.
Jährlicher Test des Warnsystems in Österreich
Jedes Jahr am ersten Samstag im Oktober wird das österreichische Warn- und Alarmsystem einem umfassenden Test unterzogen. Zwischen 12:00 und 12:45 Uhr werden die verschiedenen Zivilschutzsignale über tausende Sirenen im ganzen Land ausgestrahlt. Der Probealarm ist ein wesentlicher Bestandteil der nationalen Sicherheitsvorsorge.
Der Hauptzweck dieser Übung ist zweigeteilt. Einerseits wird die technische Zuverlässigkeit der gesamten Infrastruktur, von den Sirenen bis zu den Auslösestellen, kontrolliert. Andererseits soll die Bevölkerung mit den unterschiedlichen Signalen und deren Bedeutung vertraut gemacht werden, um im Ernstfall richtig reagieren zu können.
Der Ablauf des Probealarms
Der Test beginnt pünktlich um 12:00 Uhr mit dem Signal „Sirenenprobe“, einem 15 Sekunden langen, gleichbleibenden Dauerton. Unmittelbar danach folgen die drei Zivilschutzsignale, die im Notfall vor Gefahren warnen:
- Warnung: Ein drei Minuten langer, gleichbleibender Dauerton. Dieses Signal weist auf eine herannahende Gefahr hin und fordert die Bevölkerung auf, Radio, Fernsehen oder Online-Medien für weitere Informationen einzuschalten.
- Alarm: Ein einminütiger, auf- und abschwellender Heulton. Dieses Signal bedeutet akute Gefahr. Schutzräume sollten aufgesucht und die Anweisungen der Behörden befolgt werden.
- Entwarnung: Ein einminütiger, gleichbleibender Dauerton, der das Ende der Gefahr signalisiert.
Diese Signale bilden das Rückgrat des flächendeckenden akustischen Warnsystems in Österreich.
Hintergrund: Das Sirenennetz in Österreich
Österreich verfügt über eines der dichtesten und modernsten Sirenennetze Europas. Mehr als 8.300 Sirenen, die hauptsächlich von den Feuerwehren betrieben und gewartet werden, können im Notfall zentral oder regional aktiviert werden, um die Bevölkerung schnell und effektiv zu warnen.
Ergebnisse des Tests 2025 in Salzburg
Im Bundesland Salzburg sind insgesamt 521 Sirenen installiert. Diese Anlagen sollen im Ernstfall rund 78 Prozent der Bevölkerung in allen 119 Gemeinden akustisch erreichen und vor Gefahren wie Unfällen mit gefährlichen Stoffen oder extremen Wetterereignissen warnen.
Beim diesjährigen Probealarm funktionierten 519 dieser Anlagen ohne Probleme. Der Landesfeuerwehrverband Salzburg meldete lediglich zwei Ausfälle. Dies stellt eine Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr dar, als vier Sirenen still blieben. Die hohe Erfolgsquote von 99,62 Prozent zeigt die Zuverlässigkeit des Systems in der Region.
Digitale Warnung als Ergänzung: AT-Alert
Seit 2022 wird das traditionelle Sirenensystem durch das digitale Warnsystem „AT-Alert“ ergänzt. Dieses System sendet Warnmeldungen direkt auf Mobiltelefone und erreicht so auch Personen, die sich außerhalb der Hörweite einer Sirene befinden.
AT-Alert nutzt die „Cell Broadcast“-Technologie, bei der eine Textnachricht an alle Mobiltelefone gesendet wird, die in einer bestimmten Funkzelle eingeloggt sind. Dies ermöglicht eine geografisch zielgenaue Alarmierung. Das System hat vier Warnstufen, wobei die höchste Stufe nicht vom Nutzer deaktiviert werden kann, um sicherzustellen, dass lebenswichtige Informationen ankommen.
Während des Probealarms wurde auch AT-Alert getestet. Um 12:00 Uhr wurde eine bundesweite Gefahreninformation (Stufe 4) versendet, die nur auf Geräten angezeigt wurde, auf denen alle Benachrichtigungen aktiviert waren. Ab 12:45 Uhr lösten die Bundesländer nacheinander einen Notfallalarm der höchsten Stufe aus, der auf allen empfangsbereiten Geräten erschien. In der Testnachricht wurde explizit darauf hingewiesen, dass es sich um eine Übung handelt.
Empfehlung des Landes Salzburg
Die Behörden in Salzburg empfehlen der Bevölkerung, in den Handy-Einstellungen alle Warnstufen von AT-Alert zu aktivieren. Nur so ist sichergestellt, dass auch wichtige Informationen unterhalb der höchsten Alarmstufe empfangen werden, die beispielsweise vor regionalen Unwettern oder Verkehrsbehinderungen warnen können.
Bundesweite Bilanz des Probealarms
Österreichweit wurden bei dem Test 8.364 Sirenen überprüft. Davon funktionierten 8.327 einwandfrei, was einer nationalen Erfolgsquote von 99,56 Prozent entspricht. Die Ergebnisse zeigen, dass das Warnsystem im Großen und Ganzen sehr zuverlässig ist, es aber in einigen Regionen noch kleinere technische Mängel gibt.
Die Detailergebnisse für die einzelnen Bundesländer zeigen leichte Unterschiede in der Funktionalität der Anlagen. Während das Burgenland und Vorarlberg eine fehlerfreie Bilanz von 100 Prozent vorweisen konnten, gab es in anderen Bundesländern vereinzelte Ausfälle.
Erfolgsquoten der Bundesländer im Überblick
Die Auswertung der Ergebnisse, wie von der Austria Presse Agentur (APA) berichtet, zeigt folgendes Bild:
- Burgenland: 100% (325 von 325 Sirenen funktionierten)
- Vorarlberg: 100% (230 von 230 Sirenen funktionierten)
- Oberösterreich: 99,86% (2 Ausfälle bei 1.468 Sirenen)
- Niederösterreich: 99,71% (7 Ausfälle bei 2.450 Sirenen)
- Tirol: 99,71% (3 Ausfälle bei 1.025 Sirenen)
- Salzburg: 99,62% (2 Ausfälle bei 521 Sirenen)
- Steiermark: 99,14% (11 Ausfälle bei 1.278 Sirenen)
- Kärnten: 98,99% (9 Ausfälle bei 887 Sirenen)
- Wien: 98,33% (3 Ausfälle bei 180 Sirenen)
Die Verantwortlichen werden die Ursachen für die ausgefallenen Sirenen nun analysieren und beheben, um die volle Funktionsfähigkeit des Warnsystems für den Ernstfall sicherzustellen.